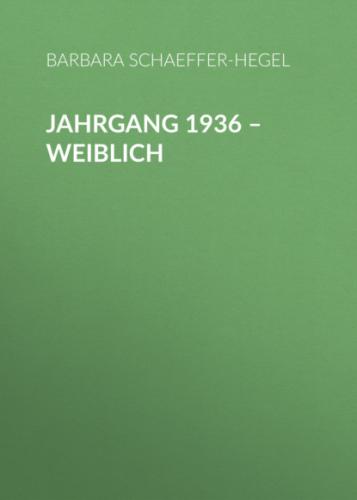Meine und Leonis Mutter kamen wohlbehalten zurück und nach ein paar Tagen konnten wir heim ins Schloss. Das Schießen hatte aufgehört und ich durfte wieder nach draußen gehen. Ich spazierte durch die Stadt, um mit eigenen Augen zu sehen, was die Bomben und die Gewehre angerichtet hatten. Schamlos präsentierte das Haus einer Mitschülerin sein Innenleben: zerbrochene Tische und Stühle, Schränke und Kommoden und überall Federn, die aus zerrissenen Daunendecken über kaputte Bettgestelle flogen. Und Bilder, die schief an der Wand hingen. Die Bäckerei war in der Mitte gespalten: zwei Häuser jetzt, die auseinanderklafften. Andere waren in Berge von Backsteinen verwandelt aus denen Teile von Möbeln herausragten wie abgetrennte Arme und Beine von Menschen, die lebendig begraben worden waren. Als ich auf die Hauptstraße kam, sah ich vor der Apotheke, die kein Dach mehr hatte Herrn Dr. Schütz auf mich zukommen. Es gab keine Möglichkeit ihm auszuweichen. So marschierte ich weiter, auf Beinen, die sich wie steife Stöcke anfühlten. Als ich Dr. Schütz fast erreicht hatte, flog mein rechter Arm nach oben, die Hand weit nach vorne gestreckt. Den anderen Arm hielt ich fest gegen meine Seite gedrückt:
»Heil Hitler, Herr Dr. Schütz!«
presste ich mit kräftiger Kinderstimme hervor. Aber dann machte Dr. Schütz, der mich noch niemals zuvor angesprochen hatte, etwas ganz Außergewöhnliches: Er trat ein paar Schritte nach vorn, beugte sich zu mir herab, ergriff meinen ausgestreckten Arm und führte ihn sanft nach unten:
»Wir grüßen jetzt nicht mehr so, Bärbelchen«,
sagte er,
»warum sagst du nicht einfach „Grüß Gott, Herr Dr. Schütz?“«.
Damit ging er weiter. Wie vom Donner gerührt blieb ich auf der Straße zurück. Nach einer Weile löste sich der Kampf in meinen Muskeln, ich schlug beide Hände vors Gesicht. Ich hatte verstanden. Der Krieg war zu Ende.
Herrn Dr. Schütz begegnete ich ein paar Jahre später wieder. Als Direktor des renommierten Stuttgarter Dillmanngymnasiums, das mein Bruder Jochen besuchte.
Nachdem wir beim Eintreffen der Amerikaner aus dem Schloss, welches sich die „Amis“ als Hauptquartier erwählt hatten, rausgeschmissen worden waren, landeten wir zunächst in einer winzigen Dachkammer in einem uralten Gasthaus in der Schnurgasse. Unser Zuhause, ein winziges Kämmerchen für vier Personen, war dunkel und eng, lag aber mitten in der Stadt, dicht neben dem Rathaus. Nach nur wenigen Wochen konnten wir jedoch in zwei Zimmer plus einer Dachkammer in die KonsulÜbele-Straße umziehen. Küche und Bad teilten wir uns mit der Hauptmieterin. Mein älterer Bruder Peter und ich mussten in der Dachkammer schlafen, in der es im Sommer brütend heiß wurde. Was uns veranlasste, nachts durch die Dachluke auf das schräge Dach zu klettern, wo mich mein Bruder anhand irgendwelcher getrockneter Blätter in die Kunst des Rauchens einführte. Auf dem Dach genossen wir ungeahnte Freiheit, fühlten uns als Herren der Welt und außerhalb jeglichen elterlichen Zugriffs. Dachten wir! Wir hatten nicht bemerkt, dass im Haus schräg gegenüber eine Frau im Rollstuhl Tag für Tag, und auch abends solange es hell war, am Fenster saß und alles beobachtete, was ihre Augen erreichen konnten. Normalerweise guckte sie auf die Straße, aber eines Abends richtete sich ihr Blick nach oben. Sie sah zwei Kinder auf einem abschüssigen Dach sitzen und bekam einen Schreikrampf. Von da an war die Dachkammer nur noch heiß und stickig, kein Fenster mehr zur Freiheit.
Die Zeit in der Konsul-Übele-Straße war auch die Zeit, in der amerikanische Soldaten in offenen LKWs durch die Straßen fuhren und den Kindern, die den Autos hinterherliefen, Kaugummis und Schokolade zuwarfen. Ein Schwarm von Kindern pflegte einem solchen Lastwagen zu folgen und manche Kinder kletterten sogar auf die Ladefläche hinauf. Ich wandte mich ab. Ich fand es abstoßend und unwürdig, dass man sich wegen ein paar Süßigkeiten vor dem „Feind“ erniedrigte. Denn Feinde waren sie doch noch immer, die amerikanischen Soldaten, oder?!
In der Konsul-Übele-Straße wohnten wir nur einen Sommer. Dann fand Mutter die Wohnung im Hause von Frau Kurtz in der Alten Amrichshäuserstraße 17, wo ich den Rest meiner Kindheit verbrachte. Die Konsul-Übele-Straße blieb mir vor allem wegen der Ausflüge aufs Dach in Erinnerung. Sie war aber auch deshalb bemerkenswert, weil ich dort meine ersten eigenen Schuhe bekam. Keine, die mein Bruder Peter schon getragen hatte, sondern ein Paar ganz neue, aus Autoreifen geschnittene Sandalen, die mit dicken Schnüren zum Festbinden versehen waren. Und ich hatte dort, obwohl noch keine 10 Jahre alt, meinen ersten Anfall von Weiblichkeitswahn. Ich schob mir zwei mit Stoffresten gefüllte kugelrunde Netze, die Art Ball, mit dem wir Kinder damals spielten, unter mein enges Sommerhemd und flanierte mit falschem Busen und stolz erhobenem Kopf die ziemlich lange Konsul-Übele-Straße hinunter. Bis mir, just in dem Moment, als mir ein Junge, den ich kannte, entgegenkam, einer der Bälle aus dem Hemd rutschte und zu Boden fiel.
5. Alte Amrichshäuser Straße 17
Erst in der Alten Amrichshäuser Straße 17, im Haus von Frau Kurtz, fand ich mein endgültiges Zuhause. Das alte Haus mit dem Holzbalkon zur Straßenseite gehörte zu den wenigen Häusern, die in den zwanziger Jahren auf der Westseite des Flusses weit außerhalb des Stadtkerns gebaut worden waren, die aber jetzt, nachdem sich das Städtchen in alle vier Himmelsrichtungen, das Tal hinauf und hinunter, und weit auf die umliegenden Anhöhen hinauf ausgedehnt hatte, zum alten Stadtteil Künzelsaus gehörten. Frau Kurtz war eine alte Dame ohne Familie. Das Haus mit dem großen Gemüsegarten vor und dem Obstgarten hinter dem Haus war ihr ein und alles. Es war in Hanglage gebaut und bestand demzufolge auf der Vorderseite aus drei, auf der Obstgartenseite nach hinten hinaus aus nur zwei Etagen.
Alte Amrichshäuser Straße 17.
Obwohl als Einfamilienhaus erbaut, hatten jetzt, kurz nach Kriegsende, insgesamt 5 Partien im Haus von Frau Kurtz Unterkunft gefunden. Zwei Familien mit Kindern, ein Ehepaar und zwei alleinstehende ältere Damen. Eine pensionierte Bibliothekarin und Frau Kurtz selbst bewohnten im ersten Stock, der Bel Etage, die zwei vorderen Zimmer mit Balkon. Im Zimmer daneben, das nach hinten hinausging und neben einem altmodischen Bad mit Holzofenboiler und einer Küche mit Kohleherd lag, wohnte ein aus Schlesien vertriebenes Ehepaar, Herr und Frau Ascherl, die noch immer auf der Suche nach ihrem einzigen Sohn waren, der in den letzten Kriegsmonaten an die Ostfront eingezogen worden war, und von dem die Eltern seither nichts gehört hatten.
Meine Familie bewohnte im Oberstock eine Küche und dreieinhalb Zimmer: Mutters Arbeits- und Schlafzimmer, ein Wohn- und Esszimmer, ein Schlafzimmer für die Kinder und ein kleines Zimmerchen, in das gerade mal ein Bett für Rosel, die „gute Seele“ unserer Familie, und ein schmaler Schrank für ihre Kleider passten. Waschen musste man sich in der Küche. Mit Rosel waren wir fünf. Meine Mutter, mein Bruder Peter, mein Bruder Jochen, Rosel und ich. Und auch später, als mein älterer Bruder für die gymnasiale Oberstufe in die Klosterschulen des württembergischen Landexamens nach Maulbronn und Blaubeuren ins Internat geschickt wurde, waren wir wieder fünf. Nachdem ein Bett im Kinderzimmer frei wurde, kam Poldi zu uns. Meine Mutter hatte ihn, der in die erste Klasse der Oberschule ging, als Pflegekind aufgenommen.
Poldis Mutter war 1946 mit einem amerikanischen Offizier nach USA entwichen. Möglicherweise in der Annahme, dass ihr Mann, Poldis Vater, nicht mehr vom Krieg zurückkommen würde. Doch Poldis Vater kam zurück. Fast zwei Jahre später und nachdem er lange nach seiner Frau und seinen beiden Söhnen gesucht hatte. Er fand Poldi und seinen Bruder Eberhard schließlich in Hohenlohe, in einem kleinen Dorf nahe Dörrenzimmern, in der Obhut seiner Eltern. Tief getroffen vom Verrat seiner Frau kehrte der Vater auf der Suche nach einem beruflichen Neuanfang in seine Heimatstadt Dresden zurück, obwohl ihn alle Freunde und vor allem seine Eltern dringend davor gewarnt hatten, sich in das Herrschaftsgebiet der Sowjets zu begeben. Ich habe nie erfahren, was Poldis Vater im Krieg und unter der Naziherrschaft gemacht hatte – ich weiß nur, dass man, nachdem er in Dresden angekommen war, nie wieder von ihm gehört hat und dass