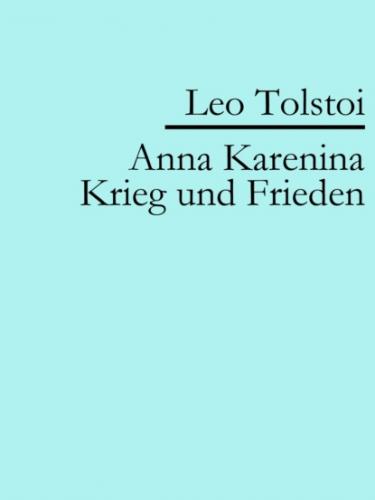»Es liegt mir nicht daran, die näheren Gründe zu hören, weswegen eine Frau ihren Liebhaber sehen muß.«
»Ich wollte ... ich wollte nur ...«, begann sie; sie war dunkelrot geworden. Sein grobes Benehmen empörte sie und machte sie mutig. »Haben Sie denn gar kein Gefühl dafür, eine wie leichte Sache es für Sie ist, mich zu beleidigen?« fragte sie.
»Beleidigen kann man einen ehrlichen Mann und eine ehrliche Frau; aber wenn man zu einem Diebe sagt, daß er ein Dieb ist, so ist das lediglich la constatation d'un fait.«
»Diesen neuen Zug von Grausamkeit habe ich an Ihnen noch nicht gekannt.«
»Das nennen Sie Grausamkeit, wenn ein Mann seiner Frau alle Freiheit läßt, sie mit dem Ehrenschilde seines Namens deckt und nur die einzige Bedingung stellt, daß der Anstand gewahrt werde. Ist das Grausamkeit?«
»Das ist schlimmer als Grausamkeit; es ist Gemeinheit, wenn Sie es denn wissen wollen!« rief Anna in einem heftigen Wutausbruche. Sie stand auf und wollte hinausgehen.
»Nein!« schrie er mit seiner kreischenden Stimme, die sich jetzt noch um einen Ton höher gehoben hatte als gewöhnlich. Mit seinen großen Fingern packte er sie so heftig am Handgelenk, daß an diesem rote Spuren von dem Armband, das er dagegengepreßt hatte, zurückblieben; so zwang er sie gewaltsam, sich wie der auf ihren Platz zu setzen. »Gemeinheit? Wenn Sie sich dieses Wortes bedienen wollen, so ist das eine Gemeinheit: den Gatten und den Sohn um des Liebhabers willen aufzugeben und doch das Brot des Gatten weiter zu essen!«
Sie ließ den Kopf sinken. Was sie gestern zu ihrem Geliebten gesagt hatte, daß er ihr wahrer Gatte sei und ihr bisheriger Gatte eine überflüssige Person, das sprach sie heute nicht aus, ja, sie dachte es nicht einmal. Sie fühlte die ganze Berechtigung dessen, was Alexei Alexandrowitsch gesagt hatte, und erwiderte nur leise:
»Sie können meine Lage nicht schlimmer darstellen, als ich sie selbst auffasse; aber warum sagen Sie das alles?«
»Warum ich das sage? Warum?« fuhr er ebenso zornig fort. »Damit Sie wissen, daß ich, da Sie meinen Willen wegen der Wahrung des Anstandes nicht erfüllt haben, nunmehr Maßregeln ergreifen werde, um dieser Lage ein Ende zu machen.«
»Sie wird schon sowieso bald ein Ende nehmen, sehr bald«, versetzte sie, und wieder traten ihr bei dem Gedanken an den nahen, jetzt ersehnten Tod die Tränen in die Augen.
»Sie wird schneller ein Ende nehmen, als Sie sich das mit Ihrem Liebhaber zurechtgelegt haben! Was Sie wünschen, ist Befriedigung der sinnlichen Leidenschaft ...«
»Alexei Alexandrowitsch! Einen am Boden Liegenden zu schlagen, zeugt nicht nur von Mangel an Großmut, sondern auch von Mangel an Anstandsgefühl.«
»Ja, Sie denken nur an sich selbst! Aber die Leiden des Mannes, der Ihr Gatte war, die sind Ihnen gleichgültig. Das kümmert Sie nicht, daß sein ganzes Leben zerstört ist und daß er so viel Leid dulch ... dulch ... dulchgemacht hat.«
Alexei Alexandrowitsch sprach so schnell, daß er ins Stottern geriet und dieses Wort gar nicht aussprechen konnte. Endlich kam »dulchgemacht« heraus. Das erschien ihr lächerlich; aber sofort schämte sie sich darüber, daß ihr in einem solchen Augenblicke etwas hatte lächerlich erscheinen können. Und zum ersten Male wurde in ihrem Herzen einen Augenblick lang ein milderes Gefühl für ihn rege, sie versetzte sich in seine Lage und bemitleidete ihn. Aber was hätte sie sagen oder tun können? Sie ließ den Kopf sinken und schwieg. Auch er schwieg einige Zeit und hob dann mit minder kreischender Stimme und in nicht ganz so kaltem Tone von neuem an, wobei er willkürlich herausgegriffene Worte betonte, die gar keine besondere Wichtigkeit hatten.
»Ich bin gekommen, um Ihnen zu sagen ...«, fing er an.
Sie blickte ihn an.
›Nein, das ist mir doch nur so vorgekommen‹, dachte sie mit Bezug auf den Ausdruck, den sie auf seinem Gesichte wahrzunehmen geglaubt hatte, als er bei dem Worte »dulchgemacht« ins Stottern geriet. ›Nein, kann denn ein Mensch mit diesen trüben Augen und mit dieser selbstzufriedenen Ruhe überhaupt irgend etwas empfinden?‹
»Ich kann nichts daran ändern«, flüsterte sie.
»Ich bin gekommen, um Ihnen zu sagen, daß ich morgen nach Moskau reise und nicht wieder in dieses Haus zurückkehren werde und daß Sie von meinem Entschlusse durch den Rechtsanwalt Nachricht erhalten werden, den ich mit der Einreichung der Klage auf Scheidung beauftragen werde. Mein Sohn aber wird zu meiner Schwester übersiedeln«, erklärte Alexei Alexandrowitsch; er erinnerte sich nur mit Anstrengung an das, was er über seinen Sohn hatte sagen wollen.
»Sie wollen Sergei nur haben, um mir wehe zu tun«, antwortete sie und warf ihm einen finsteren Blick zu. »Sie lieben ihn nicht ... Lassen Sie mir Sergei!«
»Ja, sogar die Liebe zu meinem Sohne ist mir abhanden gekommen, weil sein Anblick mich immer an meinen Abscheu gegen Sie erinnert. Aber ich nehme ihn doch für mich. Leben Sie wohl!«
Er wollte hinausgehen; aber jetzt hielt sie ihn zurück.
»Alexei Alexandrowitsch, lassen Sie mir Sergei!« flüsterte sie noch einmal. »Weiter kann ich nichts sagen. Lassen Sie mir Sergei bis zu meiner ... Ich werde bald einem Kinde das Leben geben. Lassen Sie ihn mir!«
Alexei Alexandrowitschs Gesicht bedeckte sich mit dunkler Glut; er entriß ihr seine Hand und verließ schweigend das Zimmer.
5
Das Wartezimmer des berühmten Petersburger Rechtsanwaltes war gefüllt, als Alexei Alexandrowitsch es betrat. Drei Klientinnen, eine alte Dame, eine junge Dame und eine Kaufmannsfrau mittleren Alters sowie drei Klienten, ein deutscher Bankier mit einem Siegelring am Finger, ein bärtiger Kaufmann und ein Beamter mit grimmiger Miene, in Uniform, mit einem Orden am Halse, warteten offenbar schon lange. Zwei Schreiber des Rechtsanwaltes saßen, mit Schreiben beschäftigt, an Tischen; man hörte das Geräusch ihrer Federn auf dem Papier. Die Schreibgeräte waren außerordentlich schön; Alexei Alexandrowitsch, dessen besondere Liebhaberei dies war, konnte nicht umhin, es zu bemerken. Einer der Schreiber wandte sich, ohne aufzustehen, mit zusammengekniffenen Augen ärgerlich zu Alexei Alexandrowitsch.
»Was ist Ihnen gefällig?«
»Ich habe geschäftlich mit dem Herrn Rechtsanwalt zu sprechen.«
»Der Herr Rechtsanwalt ist sehr in Anspruch genommen«, antwortete der Schreiber in strengem Tone, indem er mit der Feder auf die Wartenden wies, und schrieb dann weiter.
»Hat er nicht vielleicht dazwischen einen Augen blick für mich Zeit?« fragte Alexei Alexandrowitsch.
»Er hat keinen freien Augenblick; er ist immer beschäftigt. Bitte zu warten!«
»Möchten Sie dann nicht so freundlich sein, ihm meine Karte zu überreichen«, sagte Alexei Alexandrowitsch, da er die Notwendigkeit einsah, sein Inkognito aufzugeben.
Der Schreiber nahm die Karte hin, machte ein Gesicht, als ob ihn deren Inhalt sehr wenig befriedigte, und ging zu dem Rechtsanwalt hinein.
Alexei Alexandrowitsch billigte grundsätzlich das öffentliche Gerichtsverfahren; nur gewisse Einzelheiten in seiner praktischen Anwendung bei uns in Rußland hatten, mit Rücksicht auf höhere, ihm wohlbekannte dienstliche Verhältnisse, nicht seinen vollen Beifall, und er mißbilligte diese Einzelheiten, soweit er imstande war, etwas, was die allerhöchste Bestätigung gefunden hatte, zu mißbilligen. Sein ganzes Leben lang war er auf dem Verwaltungsgebiete tätig gewesen; so oft es daher vorkam, daß er etwas mißbilligte, wurde sein Mißvergnügen gemildert durch die Erwägung, daß Fehler bei allen Dingen unvermeidlich seien, immer aber die Möglichkeit einer Verbesserung vorliege. An der neuen Gerichtsordnung mißbilligte er die Stellung, die dem Anwaltsstande zugewiesen war. Aber bisher hatte er mit Rechtsanwälten noch nichts zu schaffen gehabt, und daher war seine Mißbilligung nur theoretisch gewesen; jetzt jedoch wurde diese Mißbilligung noch verstärkt durch den unangenehmen Eindruck, den er in dem Wartezimmer des Rechtsanwaltes empfangen hatte.
»Der