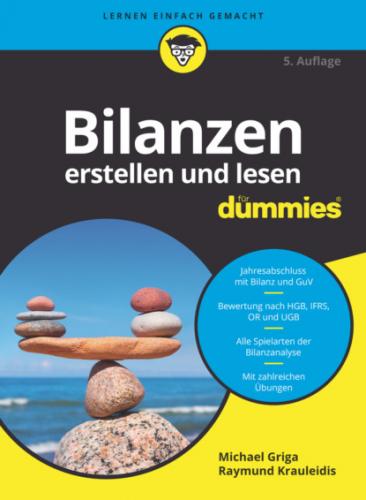Das Genossenschaftsgesetz (kurz GenG): Liebe Genossinnen und Genossen, in § 33 GenG finden Sie die spezifischen Regelungen zum Jahresabschluss. Ein Beispiel: Ist der Verlust größer als 50 Prozent der Guthaben und Rücklagen, muss der Vorstand unverzüglich die Generalversammlung einberufen. Eine überaus sinnvolle Regelung.
Das Publizitätsgesetz (kurz PublG): Das Publizitätsgesetz regelt die Veröffentlichung der Rechnungslegung. So ist zum Beispiel nach § 1 jedes Unternehmen zur Veröffentlichung seines Jahresabschlusses verpflichtet, wenn es zwei der drei Größenkriterien erfüllt: Bilanzsumme übersteigt 65 Millionen Euro, Jahresumsatz ist größer als 130 Millionen Euro, es werden mehr als 5.000 Mitarbeiter beschäftigt. Anders als in den §§ 264 ff. HGB betrifft dies nicht nur Kapitalgesellschaften, sondern alle Unternehmensformen. Die Rechtsform ist für die Veröffentlichung der Rechnungslegung durch das PublG damit egal geworden.
Neben diesen nationalen rechtlichen Grundlagen gibt es auch noch internationale Rechnungslegungsvorschriften wie das IFRS. Im Unterschied zu den nationalen Bestimmungen sind die internationalen Vorschriften jedoch keine Gesetze und damit rechtlich nicht bindend. Eigentlich.
Der Gesetzgeber hat zwischenzeitlich begonnen, diese internationalen Rechnungslegungsvorschriften mit den nationalen Gesetzen zu verlinken. Damit wird natürlich noch einmal eine viel höhere Verbindlichkeit geschaffen. Im deutschen HGB finden Sie in § 315e einen Verweis auf die internationalen Rechnungslegungsvorschriften. Damit ist das IFRS für bestimmte Unternehmen rechtlich bindend.
Rechtliche Grundlagen in Österreich und in der Schweiz
In Österreich bildet das Unternehmensgesetzbuch, kurz UGB, die wesentliche Rechtsgrundlage. Daneben gibt es auch in Österreich noch ergänzende Gesetze wie das GenG oder das GmbHG. Im UGB finden Sie die Vorschriften zur Rechnungslegung in den §§ 189 ff. Die Bilanzgliederung finden Sie in § 224 und die Gewinn-und-Verlust-Rechnung in § 231 UGB.
In der Schweiz bildet das Obligationenrecht, kurz OR, die Rechtsgrundlage. Das allgemeine Buchführungs- und Bilanzrecht finden Sie in OR 959 ff. Die Regelungen für größere Unternehmen finden Sie in OR 961 ff.
Der Aufbau der Bilanz
Wie eine doppelseitige Waage hat auch eine Bilanz zwei Seiten: eine aktive und eine passive. Ganz grob ausgedrückt, zeigen die beiden Seiten Folgendes:
Die Aktivseite einer Bilanz enthält die Vermögensgegenstände des Unternehmens, das heißt all diejenigen Sachen, die Ihrem Unternehmen gehören.
Die Passivseite zeigt auf, wie das alles finanziert wurde.
Geschickterweise stellt man beide Seiten gegenüber. Rechts und links müssen logischerweise in Summe dieselben Beträge stehen. Sonst käme die Waage ja aus dem Gleichgewicht.
Die Aktivseite
Die Vermögenswerte werden auf der Aktivseite so unterteilt:
Anlagevermögen – oder: Was dient dem Unternehmen dauerhaft?
Umlaufvermögen – oder: Was dient dem Unternehmen nur vorübergehend?
aktive Rechnungsabgrenzungsposten – oder: Periodengerechtigkeit
Umlaufvermögen ist das, was Ihrem Unternehmen nur kurze Zeit dient, indem es verbraucht oder schnell verkauft wird. Dies können etwa Vorräte, Forderungen, Aktienpakete oder die Portokasse sein.
Anlagevermögen
Das Anlagevermögen setzt sich so zusammen:
immaterielle Vermögensgegenstände
Sachanlagen
Finanzanlagen
Immaterielle Vermögensgegenstände
Die immateriellen Vermögensgegenstände kann man schlecht in die Hand nehmen oder ertasten. Beispiele sind Patente, Warenzeichen, Urheber- oder Verlagsrechte, Software sowie Konzessionen. Der § 248 des deutschen HGB sieht die Aktivierung entgeltlich erworbener immaterieller Vermögensgegenstände vor und bietet Ihnen zudem die Wahl, ob Sie selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte aktivieren möchten oder nicht. Das österreichische UGB sieht ebenfalls die Aktivierung entgeltlich erworbener immaterieller Vermögensgegenstände vor. Es verbietet aber in § 197 die Aktivierung selbst erstellter immaterieller Vermögenswerte.
Im deutschen Handelsrecht dürfen trotz großzügigen Wahlrechts aber weiterhin selbst geschaffene Marken, Drucktitel, Verlagsrechte, Kundenlisten oder ähnliche immaterielle Vermögensgegenstände nicht aktiviert werden.
Der Geschäftswert
Ihr Unternehmen kauft für 2 Millionen Euro einen Konkurrenten. Die Summe aller Vermögenswerte dieses Unternehmens betragen allerdings nur 1,7 Millionen Euro. Das war der Geschäftsleitung aber egal, da das gekaufte Unternehmen einen treuen Kundenstamm hat, der jetzt zu Ihrem Unternehmen wandert. Die Differenz von 300.000 Euro muss Ihr Unternehmen in der Bilanz nach § 301 Abs. 3 Satz 1 HGB als Geschäfts- oder Firmenwert ausweisen. Hierbei handelt es sich ebenfalls um einen immateriellen Vermögensgegenstand, der allerdings in der Bilanz gesondert erscheint.
Sachanlagen
Sachanlagen schaffen neben den immateriellen Vermögensgegenständen die Voraussetzungen dafür, dass Ihr Unternehmen überhaupt etwas produzieren oder leisten kann. Wichtigste Vertreter wären hierbei:
Grund und Boden: Ein süddeutsches Sprichwort besagt: »Liebe vergeht, Grundstück besteht«. Ähnlich ist der Bilanzansatz. Da der Grund und Boden in der Regel keiner Abnutzung unterliegt, sind Grundstücke über die Jahre hinweg mit dem Kaufpreis, also mit den Anschaffungskosten anzusetzen. Abgeschrieben wird nicht.
Gebäude: Bei Gebäuden sieht das schon ein klein wenig anders aus. Gebäude nutzen sich ab und werden im Laufe der Zeit immer weniger wert. Somit können Gebäude über ihre Lebensdauer abgeschrieben werden. Das bedeutet, dass ein Gebäude von Jahr zu Jahr auch mit geringeren Werten in der Bilanz erscheint.
Maschinen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung: Hierzu zählen zum Beispiel Ihre Produktionsanlagen, Ihr Schreibtisch oder Ihr Rechner. Bei selbst erstellten Sachanlagen wie zum Beispiel Maschinen müssen Sie die Herstellungskosten ansetzen. Wurden sie dagegen gekauft, müssen Sie die Anschaffungskosten als