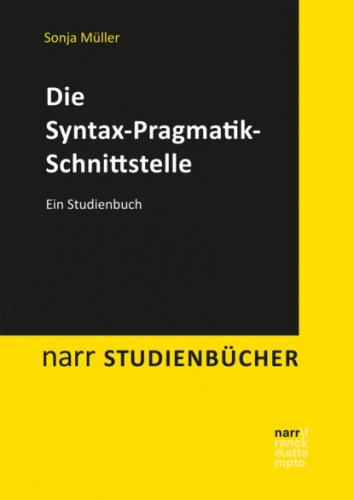Über die Natur der Alternativen macht diese Definition keine Aussage und es lassen sich tatsächlich u.a. verschiedene Funktionen von FokusFokusfunktionen unterscheiden (vgl. Krifka 2007: 21ff., Musan 2010: 42f.).
| (54) | A: | Was tut weh? |
| B: | [Fokus Mein ZAHN] tut weh. |
| (55) | A: | Eva hat [Fokus eine RATte]. | |
| B: | Nein, Eva hat [Fokus eine KATze]. | (Musan 2010: 43) |
| (56) | A: | Eva hat [Fokus eine RATte]. |
| B: | Ja, Eva hat [Fokus eine RATte]. |
| (57) | Mareike hat [Fokus ein KaNINchen]. Eva hat [Fokus eine KATze]. |
| (Musan 2010: 43) |
In (54) liefert die fokussierte Einheit als Antwort auf die Frage tatsächlich neue Information, man spricht von einem InformationsfokusInformationsfokus. Die Fokusalternativen werden durch die Frage eröffnet (Zahn, Arm, Bein etc.). In (55) spricht man von einem KorrekturfokusKorrekturfokus. Eine Aussage der Form Eva hat X. muss unmittelbar vorangegangen sein, der korrigierte Ausdruck wird verneint. Ähnlich muss in (56) eine (in diesem Fall genauer die gleiche) Aussage vorangegangen sein. Der fokussierte Ausdruck wird allerdings nicht verneint, sondern bestätigt (BestätigungsfokusBestätigungsfokus). In (57) werden die beiden Fokuseinheiten gegenübergestellt, weshalb man diesen Fall als KontrastfokusKontrastfokus bezeichnet.
Der FokusakzentFokusakzent wird einer Silbe aus dem FokusbereichFokusbereich zugeordnet. Wenn ein einsilbiges Wort vorliegt und nur dieses Wort alleine der Fokus der Äußerung ist, entspricht die akzentuierte Silbe der Fokuseinheit (vgl. (58)).
| (58) | A: | Wen hat Irma eingeladen? |
| B: | Sie hat [Fokus HANS] eingeladen. |
Wenn ein Wort, das alleine den Fokus bildet, aus mehr als einer Silbe besteht, erhält diejenige Silbe den Fokusakzent, die den Wortakzent trägt:
| (59) | A: | Wen hat Irma eingeladen? |
| B: | Sie hat [Fokus STEfan] eingeladen. |
Besteht eine NP aus mehr als einem Nomen, ist zwar auch die Silbe des Nomens akzentuiert, die NP steht aber als Ganzes im Fokus (vgl. (60)).
| (60) | A: | Wen hat Irma eingeladen? |
| B: | Sie hat [Fokus ihren SCHULfreund] eingeladen. |
Die akzentuierte Silbe bezeichnet man als FokusexponentenFokusexponent. Die Beispiele in (58) bis (60) zeigen, dass der Fokus genauso groß sein kann wie der Fokusexponent, der Fokusbereich aber auch größer sein kann. Dass eine NP im Fokus steht, kann über den Test durch die Bildung einer w-Frage abgeleitet werden. Man kann dies weiterführen und dadurch zeigen, dass auch größere Bereiche eines Satzes ggf. Fokus sein können. In (61) und (62) zeigen die Fragen an, dass die VP bzw. CP den Fokus bildet.
| (61) | A: | Was hat Irma gemacht? |
| B: | Sie hat [Fokus ihren SCHULfreund eingeladen]. |
| (62) | A: | Was war los? |
| B: | [Fokus Irma hat ihren SCHULfreund eingeladen]. |
Wird das Nomen Schulfreund akzentuiert, kann die NP anscheinend alleine den Fokus bilden (enger FokusEnger Fokus), es können aber auch größere Teile des Satzes den Fokus ausmachen (weiter Fokusweiter Fokus). Das Verhältnis zwischen Fokusexponent und Fokusbereich bezeichnet man als FokusprojektionFokusprojektion bzw. FokusvererbungFokusvererbungFokusprojektion. Das heißt, der Fokus wird von dieser Silbe auf größere Teile des Satzes projiziert. Es ist Gegenstand der Forschung, die Bedingungen zu formulieren, unter denen Fokusprojektion möglich ist (vgl. z.B. Selkirk 1995, Büring 2006). Wichtig ist, dass wir sehen, dass Fokus und Akzent nicht stets zusammenfallen.
1.2.2 Topik-Kommentar-Gliederung
Eine weitere Dimension der Informationsstruktur ist die Dichotomie von TopikTopik und KommentarKommentar. (63) beispielsweise interpretiert man ganz natürlich als einen Satz über Brigitte, und was über Brigitte ausgesagt wird, ist, dass sie das Radfahren liebt.
| (63) | [Topik Brigitte] [Kommentar liebt das Radfahren]. |
In (63) steht das Topik im VorfeldVorfeld. Dies muss aber nicht so sein. In (64) steht es im MittelfeldMittelfeld.
| (64) | Was gibt’s Neues über das Stadtschloss? |
| Laut Bürgermeister Jacobs wird man dieses furchtbare Gebäude nächstes Jahr endlich abreißen. (Fanselow 2006: 6) |
In manchen Fällen kann auch allein der Kontext auflösen, welche Einheit das Topik ist. In (65) können prinzipiell Hans (vgl. (66)) oder Maria (vgl. (67)) das Topik sein.
| (65) | Hans hat Maria zum Tanz aufgefordert. |
| (66) | A: |