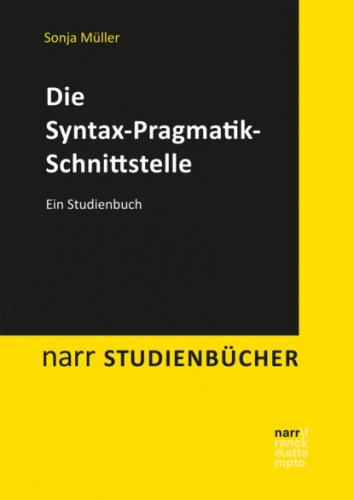|
|
B:
|
[Topik Hans] [Kommentar hat Maria zum Tanz aufgefordert].
|
|
(67)
|
A:
|
Erzähl mir von Maria.
|
|
|
B:
|
[Kommentar Hans hat] [Topik Maria] [Kommentar zum Tanz aufgefordert].
|
|
|
|
(nach Erteschik-Shir 2007: 15)
|
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Kontexte zu konstruieren, die ein Topik als solches auszeichnen. Dazu gehört z.B. der FragetestFragetest, den wir bereits eingesetzt haben, um die Fokus-Hintergrund-GliederungFokus-Hintergrund-Gliederung (FHG) zu bestimmen. In (68) fordert die Frage Informationen zu einer Einheit, die dann entsprechend als Topik interpretiert wird. Das, was in der Frage an Information fehlt, ist der Kommentar.
|
(68)
|
A:
|
Was hat Albert gemacht?
|
|
|
B:
|
[Topik Albert] [Kommentar hat Saxophon gespielt].
|
Das Topik kann auch über EinleitungssequenzenEinleitungssequenz wie in (69) bis (71) nahegelegt werden (vgl. Musan 2010: 28f.).
|
(69)
|
Ich erzähle dir etwas über Albert.
|
|
|
[Topik Albert] [Kommentar lernt jetzt Harfe spielen].
|
|
(70)
|
Es gibt etwas Neues über Albert.
|
|
|
[Topik Albert] [Kommentar lernt jetzt Harfe spielen].
|
|
(71)
|
Hast du das über Albert schon gehört?
|
|
|
[Topik Albert] [Kommentar lernt jetzt Harfe spielen].
|
Auch gibt es einige spezielle Konstruktionen, die dazu verwendet werden können, das Topik eines Satzes zu kodieren. Für die Strukturen in (72) bis (74) hat man z.B. angenommen, dass sie die am linken Satzrand stehende Einheit als Topik auszeichnen.
|
(72)
|
[Topik Meinen Onkel,] [Kommentar den habe ich lange nicht gesehen].
|
|
(73)
|
[Topik Mein Onkel,] [Kommentar ich habe ihn lange nicht gesehen.]
|
|
(74)
|
Was [Topik Miriam] betrifft, [Kommentar so weiß ich nicht, warum sie heute zu spät kommt]. (Musan 2010: 33f.)
|
(72) ist eine sogenannte LinksversetzungLinksversetzung, die sehr ähnliche Struktur in (73) bezeichnet man als Hängendes TopikHängendes Topik und (74) ist ein Beispiel für ein Freies ThemaFreies Thema.
Aus der Möglichkeit von Frage-Antwort-SequenzenFrage-Antwort-Sequenz wie in (68) und (71) darf nicht gefolgert werden, dass Topik und Bekanntes bzw. Kommentar und Unbekanntes immer gleichzusetzen sind. Dies wird suggeriert, da das Topik bereits in der Frage vorkommt und der Kommentar der Teil der Äußerung ist, den die Frage erfragt. Unter der Sicht, dass der Fokus mit neuer Information assoziiert wird, erfolgt die Auszeichnung von Topik und Kommentar hier parallel zur FHG.
|
(75)
|
A:
|
Was hat Albert gemacht?
|
|
|
B:
|
[Topik Albert] [Kommentar hat Saxophon gespielt].
|
|
|
B:
|
[Hintergrund Albert] [Fokus hat Saxophon gespielt].
|
Die Beispiele in (76) und (77) illustrieren, dass die Auszeichnungen nicht parallel verlaufen müssen.
|
(76)
|
A:
|
Was haben die Kunden gelesen?
|
|
|
B:
|
Eine Frau hat eine Computerzeitschrift gelesen.
|
|
(77)
|
A:
|
Auf dem Tisch liegen so viele Bücher – die Bibel, „Harry Potter und der Halbblutprinz“, „Die Forsyte-Saga“. Was hat Eva gelesen?
|
|
|
B:
|
Eva hat „Harry Potter und der Halbblutprinz“ gelesen.
|
|
|
|
(Musan 2010: 29)
|
In (76) wird eine Aussage über die gelesenen Dinge durch Kunden gemacht (vgl. (78a)). Bekannt ist aber nur, dass überhaupt etwas gelesen wurde, d.h. sowohl die Frau als auch die Zeitschrift können als unbekannte Information gelten (vgl. (78b)). Im Topikbereich tritt somit unbekannte Information auf.
|
(78)
|
a.
|
[Topik Eine Frau] [Kommentar hat eine Computerzeitschrift] [Topik gelesen].
|
|
|
b.
|
[Fokus Eine Frau] [Fokus hat eine Computerzeitschrift] [Hintergrund gelesen].
|
|
|
|
(Musan 2010: 29)
|
In (77) wird Information über Evas gelesene Bücher verlangt (vgl. (79a)). Sowohl Eva als auch das Buch als auch die Tätigkeit des Lesens sind im Kontext vorerwähnt und in diesem Sinne Teil des Hintergrunds. In diesem Beispiel liegt somit bekannte Information im Kommentar vor.
|
(79)
|
a.
|
[Topik Eva hat] [Kommentar „Harry Potter und der Halbblutprinz“] [Topik gelesen].
|
|
|
b.
|
[Hintergrund Eva hat] [Hintergrund „Harry Potter und der Halbblutprinz“] [Hintergrund gelesen].
|
|
|
|
(Musan 2010: 29)
|
Das heißt, Topikstatus kann, muss aber nicht, mit Bekanntheit und Kommentar mit Unbekanntheit korrelieren.
Diese Erkenntnis ist relevant vor dem Hintergrund, dass in der Literatur zwei verschiedene Topikdefinitionen vorgeschlagen worden sind. Die Auffassung, die wir bisher vertreten haben, nach der das Topik der Satzgegenstand ist, ist bekannt als Aboutness Topik-Definition Aboutness Topik(vgl. z.B. Reinhart 1981, Molnàr 1991). Folgt