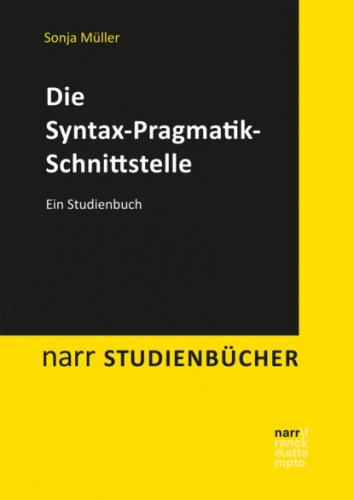Wenn nicht anders bezeichnet, gehen wir im Folgenden weiterhin von der Aboutness-Auffassung aus, da sich herausstellen wird, dass dieses Konzept in den im weiteren Verlauf dieses Buches untersuchten Phänomenen, bei denen der Topikstatus eine Rolle spielt, das relevante sein wird. Der Satzgegenstand sollte aber natürlich identifizierbar sein und das ist er oftmals aus dem Grund, dass der Referent schon bekannt ist. Pronomen eignen sich aus diesem Grund auch gut als Topikkonstituente.
Unter diesem Topikkonzept scheint es nicht sinnvoll, anzunehmen, dass es Sätze ohne Topik gibt. Für die Beispiele in (80) und (81) stellt sich dann aber die Frage, wie das Topik hier jeweils zu benennen ist.
| (80) | a. | Es findet ein Markt statt. |
| b. | Es war einst ein Zauberer. |
| (81) | a. | Es regnet. |
| b. | A: Was ist los? | |
| B: Das TElefon klingelt. (Lambrecht 1994: 140/177/141/143) |
In allen diesen Fällen bietet sich keine Interpretation an, unter der sich die Sätze in Topik und Kommentar gliedern. In (80) wird eher ein Referent eingeführt bzw. dessen Existenz festgestellt. In Folge könnten der dann etablierte Markt bzw. der Zauberer als Topik fungieren. In (81) wird jeweils ein Ereignis eingeführt. In (81a) bietet sich das ExpletivumExpletivum sehr deutlich nicht als Satzgegenstand an und auch in (81b) wird (anders als in (82)) keine Aussage über das Telefon gemacht.
| (82) | A: | Was ist denn schon wieder mit dem Telefon los? |
| B: | Das Telefon KLINgelt. |
Sätze wie in (80) und (81) bezeichnet man als thetische SätzeThetischer Satz. Lambrecht (1994: 144) teilt diese Klasse in präsentationelle StrukturenPräsentationeller Satz wie in (80), die einen Referenten einführen, und ereignisberichtende SätzeEreignisberichtender Satz, die Ereignisse einführen (vgl. (81)).
Eine Möglichkeit ist nun, derartige Sätze als Ausnahmen anzusehen. Unter dieser Sicht handelt es sich um topiklose Strukturen. Erteschik-Shir (2007: 16f.) hingegen vertritt, dass hier Situationen als Topik auftreten. Wollte man Sätze dieser Art auf ihre Wahrheit hin untersuchen, würde man den Ort und/oder die Zeit ausmachen, auf die Bezug genommen wird, und die Aussage auf diese beziehen. Im Falle von (81a) würde man z.B. an einem bestimmten Ort nach draußen schauen, in (81b) fragt man nach der Gegebenheit an einem bestimmten Ort zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und auch in (80) würde man überprüfen, ob die genannten Entitäten zum gemeinten Zeitpunkt/am gemeinten Ort existieren. Erteschik-Shir bezeichnet derartige Topiks als implicit stage topicimplicit stage topic, das die spatio-temporalen ParameterSpatio-temporaler Parameter des Satzes aufzeigt. Da jede Konversation zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort stattfindet, ist ein derartiges Topik immer verfügbar. Ein Stage-Topik ist folglich ein nicht-overt realisiertes Topik.
Ein weiterer Fall eines nicht sichtbaren Topiks lässt sich beim Phänomen des Topik-DropTopik-Drop, illustriert in (83) und (84), beobachten.
| (83) | A: | Heute hab ich den Hans gesehen. |
| B: | Echt? __ Ist mir ja schon seit Ewigkeiten nicht mehr begegnet. |
| (84) | A: | Heute ist mir der Hans begegnet. |
| B: | Echt? __ Hab ich ja schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. | |
| (Trutkowski 2016: 3) |
Auch hier ist kein Topik sichtbar, man interpretiert die Aussagen in den Beiträgen von B aber als Information (und damit Kommentar) über Hans. (Für einen Überblick über die Bedingungen des Topik-Drop und theoretische Rekonstruktionen dieses Phänomens vgl. z.B. Helmer 2016, Trutkowski 2016.)
Unter Bezug auf die Aboutness Topik-DefinitionAboutness Topik lässt sich auch erfassen, warum nicht alle sprachlichen Einheiten als Topik geeignet sind. Eine Voraussetzung für den Topikstatus ist plausiblerweise, dass der Ausdruck referieren kann (vgl. Reinhart 1981: 65ff., Frey 2004a: 174), d.h. sich auf eine außersprachliche Entität beziehen kann, über die eine Aussage gemacht wird. Angenommen, die LinksversetzungLinksversetzung (LV) zeichnet die Konstituente am linken Satzrand als Topik aus, kann diese Struktur als Testboden dienen. Einheiten, die sich schlecht als Topik eignen, sollten nicht gut auftreten können. Dies scheint tatsächlich der Fall zu sein: Während eine definite NPDefinite Nominalphrase (vgl. (85a)) gut in einer LV stehen kann, gilt dies nicht gleichermaßen für die quantifizierten PhrasenQuantifizierte Nominalphrase in (85b) bis (85d), die Aussagen über Mengen machen und hier nicht eindeutig die Einheiten identifizieren, auf die die Aussage zutreffen soll.
| (85) | a. | Der Student aus Bielefeld, der hat die Klausur bestanden. |
| b. | ??Irgendjemand, der hat die Klausur bestanden. | |
| c. | *Keiner, der hat die Klausur bestanden. | |
| d. | *Mehr als drei Studenten, die haben die Klausur bestanden. |
Dies bedeutet allerdings nicht, dass quantifizierte Phrasen generell keine Topiks bilden können. Die Sätze in (86) sind wesentlich akzeptabler als die Beispiele in (85b) bis (d).
| (86) | a. | ?Drei Studenten, die sind durchgefallen. |
| b. | ?Alle Studenten, die möchten den Kurs bestehen. |
Dies ist darauf zurückzuführen, dass in (86) die Mengen klarer identifiziert werden können und somit über diese bzw. ihre Mitglieder etwas ausgesagt werden kann.
Wenngleich Topiks typischerweise über (NP-)Argumente realisiert werden, können auch adverbiale Bestimmungen diese Rolle übernehmen. In (87a) realisiert eine PP, die die Funktion eines lokalen AdverbialsLokales Adverbial hat, das Topik, in (87b) ein temporales AdverbialTemporales Adverbial in Form eines Adverbs.
| (87) | a. |
|