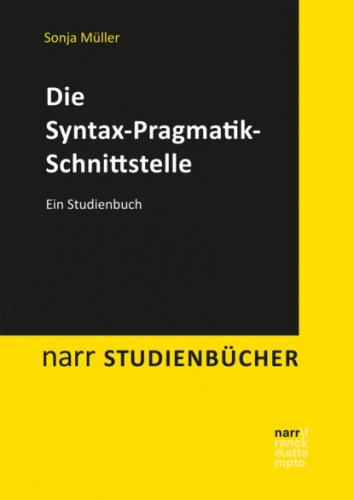1.1.2 Hierarchische Aspekte der Wortstellung
Nach derartigen linearen Generalisierungen betrachten wir im Folgenden ein komplexeres Modell, das auch für Hierarchien aufkommt (vgl. z.B. Grewendorf & Hamm & Sternefeld 1987: 213–227). Im TFM ist allein entscheidend, dass bestimmte Wörter überhaupt Konstituenten bilden, weil es z.B. die Beschränkung gibt, dass im VF nur eine Konstituente stehen kann. Konstituenten sind allerdings intern strukturiert. Der Pfarrer ist intuitiv sicherlich von geheiratet zu unterscheiden, wenngleich beide Konstituenten gleichermaßen im VF stehen können.
Man hat sich zahlreiche Strukturen von Phrasen angeschaut und herausgefunden, dass sie unter einem bestimmten Abstraktionsniveau gleich aufgebaut sind. Das Ergebnis dieser Analyse ist die sogenannte X'-TheorieX'-Theorie (lies: X-bar), die für alle Phrasen in allen Sprachen die Struktur in (7) voraussagt.
Nicht in allen Phrasen hat man einen Spezifikator. Tritt er nicht auf, kann die Zwischenebene der Repräsentation (X') ausgelassen werden. Die Phrase besteht dann aus XP und X0. (Zur X'-Theorie vgl. z.B. Fanselow & Felix 1993: 40–61, Philippi & Tewes 2010: 82–100).
Mit diesem Strukturerzeugungsmechanismus lassen sich verschiedenste Arten von Phrasen generieren bzw. analysieren. In (8) liegen jeweils VerbalphrasenVerbalphrase (VPn) vor. Das Verb ist der Kopf der Phrase, es bestimmt über die Gestalt seines Komplements. Das Dreieck verwendet man in der Darstellung, wenn die interne Struktur der Phrase übergangen wird (vgl. z.B. (9) und (10)). Der Spezifikator der VP ist z.B. besetzt, wenn zwei Objekte beteiligt sind, wie in (10).
| (8) | a. | [ein Buch] kaufen |
| b. | [dass Hans ein Eis isst] sagen | |
| c. | [in den Urlaub] fahren |
(11) zeigt Beispiele für NominalphrasenNominalphrase (NPn).
| (11) | a. Tochter [des Arztes] |
| b. Entdeckung [Amerikas] |
Bei NPn ist die Spec-Position z.B. besetzt, wenn ein Artikel auftritt (vgl. (13)).
In (14) liegen PräpositionalphrasenPräpositionalphrase (PPn) vor.
| (14) | a. | auf [dem Baum] |
| b. | unter [dem Tisch] |
In (16) treten AdjektivphrasenAdjektivphrase (APn) auf.
| (16) | a. | [auf das Fahrrad] stolz |
| b. | [dem König] treu |
In allen Beispielen projiziertProjektion ein Kopf eine Phrase. Weitere Elemente, die vom Kopf gefordert werden, treten hinzu. Dabei muss ein Kopf keine derartigen Forderungen an Komplemente stellen. Er kann auch alleine eine Phrase aufspannen. (18) und (19) zeigen zwei Beispiele.
In (8a) hat kaufen z.B. eine Leerstelle für eine NP im Akkusativ (AKK), in (12) Tochter für eine NP im Genitiv (GEN), in (15) auf für eine NP im Dativ (DAT) und in (17) stolz eine für eine PP. Jegliche fakultative Angaben, die nicht vom Kopf gefordert sein können, sind nicht Teil der Phrase. Um auch adverbiale BestimmungenAdverbial wie schnell in schnell zur Schule gehen in der Struktur abzubilden, gibt es die Operation der AdjunktionAdjunktion. Dabei wird der Knoten einer XP verdoppelt, wodurch eine Position geschaffen wird: Da sich schnell in (20) auf die VP bezieht, wird in diesem Fall der VP-Knoten verdoppelt.
Betrachtet man eine VP wie in (21), etabliert der verbale Kopf eine Situation. Das heißt, bekannt sind die Verbsemantik sowie die Mitspieler (NPs, PPs).