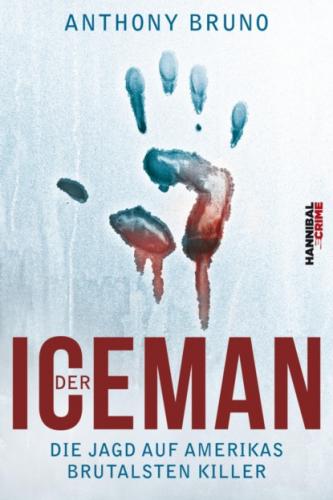Als er jedoch wieder nach seinem geheimen Lager sehen wollte, war die Kiste verschwunden. Irgendjemand hatte sie gefunden und seinen Wein mitgenommen. Garantiert steckte Johnny dahinter.
In einiger Entfernung überquerte ratternd ein Zug die Bertonbrücke an der Newark Avenue, der entweder in Richtung des Rangierbahnhofs fuhr oder von dort kam. Richies Vater arbeitete bei der Eisenbahn als Bremser. Jedenfalls glaubte er das, aber er war nicht sicher. Das letzte Mal hatte er ihn vor zwei Jahren bei der Geburt seiner kleinen Schwester gesehen. Er war abgehauen, als Richie noch ein kleines Kind gewesen war, doch ab und zu stand er urplötzlich vor der Tür wie ein Seemann, der auf Landgang nach Hause kam. Sein Erscheinen bedeutete allerdings kein besonderes Vergnügen. Er war hitzköpfig, und offenbar machte es ihm Spaß, seinen ältesten Sohn völlig grundlos zu verprügeln. Stinkbesoffen kam er brüllend ins Kinderzimmer gestürmt, tobte wegen irgendeiner Nichtigkeit und zog dann den Gürtel aus seiner Hose. Es war nicht so schlimm, wenn die Mutter zu Hause war; dann dauerte die Dresche gewöhnlich nicht lange, weil sie versuchte, ihn zurückzuhalten und ebenso lautstark brüllte und kreischte. Richie war zu dem Schluss gekommen, dass sein Alter genau wie alle anderen war. Das Einzige, was er im Grunde wollte, war ein wenig Beachtung, und deshalb würde er wieder seinen Gürtel nehmen und loslegen, wenn die Mutter bei der Arbeit war; es gab nichts, was ihn davon abhalten konnte. Richie konnte nur versuchen, es zu ertragen und währenddessen an etwas anderes zu denken.
Natürlich wurde er auch von seiner Mutter geschlagen, aber sie hatte nicht so viel Kraft und Ausdauer, wenn sie zum Besenstiel griff, und es tat nicht mal halb so weh. Sie schuftete dermaßen in der Armour-Fleischfabrik, dass sie kaum Zeit fand, ihre Kinder zu verdreschen. Allerdings hatte sie andere Methoden, mit denen sie es schaffte, dass man sich klein und mies fühlte. Bessere Methoden. Sie machte es mit Worten, boshaften, hämischen, verletzenden Worten, nach denen Richie sich wie der letzte Dreck vorkam und überzeugt war, dass ihre Verbitterung und Enttäuschung über das Leben allein seine Schuld waren und dass er etwas tun sollte, um es wieder gutzumachen. Dabei wusste er gleichzeitig, dass alles zwecklos war. Wenn er es sich recht überlegte, war sie eigentlich noch schlimmer als der Alte.
Aber bei den Eltern blieb einem nichts weiter übrig, als sich damit abzufinden; von einem anderen Kind dagegen durfte man sich nichts gefallen lassen. Es gehörte sich, dass man sich wehrte, so wie es die Cowboys in den Filmen machten. Genau deshalb stand er jetzt hier in der Dunkelheit gegen die warme Ziegelwand gedrückt und hielt die Kleiderstange bereit, um sich endlich zur Wehr zu setzen und zurückzuschlagen.
Johnny verhöhnte ihn nicht nur, er schlug ihn auch gern zusammen. Er wohnte im Erdgeschoss desselben Hauses und hatte seine eigene Bande. Ständig triezte er ihn, wenn seine Truppe dabei war, um sich wichtig zu machen und um zu zeigen, wer hier der Anführer war. Am Anfang hatte Richie versucht, sich zu verteidigen, aber wenn er bloß eine Hand gegen Johnny erhob, fielen die anderen sechs Kinder, die ebenfalls in dieser Siedlung an der 16. Straße lebten, mit Boxhieben und Tritten über ihn her. Nach einer Abreibung, bei der er eine geplatzte Lippe kassierte und sich einen Monat lang mit dumpfen Schmerzen in der Seite quälte, hatte er gelernt, dass es besser war, es einfach hinzunehmen, genau wie die Dresche seines Vaters. Das ging schneller. Aber es war schwer. Johnnys zur Schau getragene Überheblichkeit machte ihn rasend, und die Demütigung, von der ganzen Bande ausgelacht zu werden, zerfraß ihn innerlich.
Richie zitterte vor aufgestautem Hass, wenn er nur an Johnny und seine blöde Meute dachte. Er klopfte mit der Stange auf den asphaltierten Boden. Nein. Es reichte jetzt wirklich. Er würde sich nichts mehr gefallen lassen.
Schritte erklangen im Hof, und ihm blieb fast das Herz stehen. Jemand kam in:seine Richtung. Langsam hob er die Stange. Seine Arme waren bleischwer, und er fühlte sich wie gelähmt.
Die Schritte kamen näher.
Richie wünschte, er könnte aufhören zu zittern. Am liebsten wäre er weggelaufen, aber er wollte nicht immer davonrennen. Johnny sollte seine Lektion kriegen und sich merken, dass er nicht länger auf Richard Kuklinski herumhacken konnte. Er wollte einfach nur in Frieden leben und bloß in Ruhe gelassen werden.
Die Schritte waren schon so nahe, dass er ihn treffen müsste, als er ein Gesicht in der Dunkelheit erkannte.
»Richie?«
Hastig ließ er die Stange sinken und versteckte sie hinter seinem Bein. Es war Mr. Butterfield, der auf demselben Flur wohnte. Er hatte eine Bierflasche in der Hand, und Richie merkte, dass dies nicht seine erste war. Mr. Butterfield war ein Trinker, der ebenfalls regelmäßig seine Kinder schlug.
»Weiß deine Mutter, dass du so spät noch draußen bist?«
Richie zuckte die Schultern. »Ist mir egal.« Sie war am Radio eingeschlafen, genau wie jeden Abend.
»Du gehst besser heim. Es ist doch schon so spät.«
Butterfield nahm einen Schluck aus seiner Flasche und torkelte weiter.
Wütend schaute er ihm hinterher. Der Mistkerl scherte sich einen Dreck um seine eigenen Bälger, aber dann große Töne spucken, als mache er sich Gedanken um fremde Kinder! Dieser gottverdammte Heuchler mit seinem blöden Geschwätz.
Richie überlegte, ob es wirklich schon so spät war. Er besaß keine Uhr, jedenfalls keine, die funktionierte. Unwillkürlich musste er an seine Firmung vor drei Jahren denken, und ein Gefühl tiefer Demütigung brannte in ihm wie immer, wenn er sich daran erinnerte.
Johnny hatte einen neuen blauen Anzug getragen, ein weißes Hemd, eine silbergraue Krawatte und die lilienweiße Binde aus Satin am Oberarm. Er ähnelte eher einem jungen Gangster als einem Firmling. Garantiert hatte er die verdammten Klamotten gestohlen, denn schließlich war er genauso arm wie alle anderen in der Siedlung. Aufgeplustert stolzierte er nach der Zeremonie wichtigtuerisch die Kirchenstufen hinunter – ein neuer Streiter in der Armee Christi. Auch so eine schwachsinnige Scheiße von den scheinheiligen Nonnen. Warum sollte Gott ein solches Arschloch in seiner Schar haben wollen? Warum durfte überhaupt jemand wie Johnny gefirmt werden? Bloß weil er einen feinen Anzug hatte? Lauter gottverfluchte scheinheilige Heuchler, alle miteinander.
Richard hatte an diesem Tag dieselben uralten Sachen getragen wie immer: die braunen Hosen, ein abgewetztes gestreiftes Hemd und seinen dunkelblauen Wollmantel. Es war April, aber er musste den Wintermantel anziehen, weil er sonst nichts anderes besaß und seine Mutter darauf bestanden hatte. Er wusste noch genau, wie mühsam er sich die Armbinde über den Mantelärmel gestreift hatte, wobei er ständig fürchtete, dass der Gummizug riss, und sich wünschte, seine Mutter hätte sie ihm angelegt. Aber sie musste arbeiten, an Sonntagen bekam sie fünfzig Prozent Zuschlag. Sein jüngerer Bruder und die kleine Schwester blieben bei einer Nachbarin.
Richie war allein zur Kirche gegangen, und er tat, was die Nonnen ihm beigebracht hatten. Zusammen mit den anderen kniete er am Altar, als der Bischof die Reihe entlangging, etwas auf Latein murmelte, den Daumen in geweihtes Öl tauchte, jede Stirn salbte und jede Wange mit dem symbolischen Backenstreich berührte. Richard empfand nur Gleichgültigkeit und Leere. Nachdem es vorbei war und die anderen Kinder zu ihren wartenden Familien rannten, stand er einfach auf, um heimzugehen, und überlegte, ob noch irgendwas Essbares im Kühlschrank war, damit er sich ein Sandwich machen könnte.
Als er die Treppenstufen hinunterkam, erblickte er Johnny mit seiner Familie. Sie veranstalteten ein Mordstheater um ihn. Er lächelte und hielt sein Handgelenk hoch, damit alle es sehen konnten, und seine Mutter quiekte: »Bedank dich bei deinem Onkel Mario, Johnny. Sag Dankeschön.« Er hatte eine neue Armbanduhr. Sie war aus Gold mit einem vergoldeten Edelstahlband. Er brüstete sich immer mit seinem reichen Onkel, der ihm lauter Sachen schenke, aber bis jetzt hatte Richard kein Wort davon geglaubt. Seine Mutter hatte sich nicht mal die Mühe gemacht, Onkel Mickey zu sagen, dass er gefirmt wurde.
Rasch schob er sich durch die Menge und bemerkte, dass auch die anderen