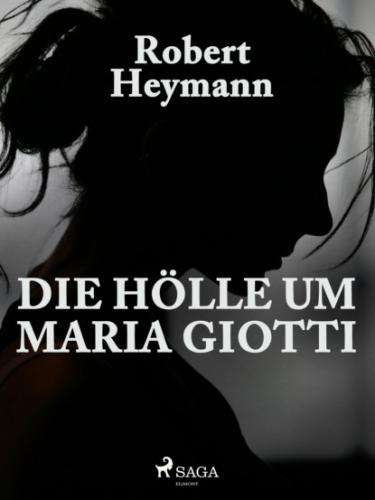„Wieso? Er wohnt doch schräg über dieser Wohnung?“
„Si! Si! Aber er kommt oft wochenlang nicht — ist viel auf Reisen, ich habe ihn schon lange Zeit nicht gesehen!“
„Seit dem 28. August nicht?“
„Länger nicht! Wochen nicht!“
„Das stimmt nicht!“ wirft Nipulos ein. „Ich habe ihn vor vierzehn Tagen besucht!“
„Ein Beweis, daß Sie nicht alle Leute sehen, die aus und eingehen“, sagt der Kommissar zur Portière. „Graf Martini kann also doch noch abends ausgegangen sein! Es ist nun von ungeheurer Wichtigkeit, daß wir feststellen, welcher Mann um acht Uhr aus der Wohnung des Grafen Martini gekommen ist. Verstört, wie Herr Nipulos behauptet.“
„Ja, Herr Inspektor. Mit irrem Blick, ich sah ihn vorbeirennen, aber er bemerkte mich nicht. Raste die Treppen hinab, verschwand — wie ein Wahnsinniger!“
Die Beamten lassen bei Herrn Pizotti nachforschen. Die Wohnung ist verschlossen, an der Tür ein Schild: „Verreist!“
Die Bewohnerin der Räume über dem Grafen Martini, Signora Santoni, hat auf ihre Vernehmung gewartet. Sie erklärt mit Bestimmtheit, daß sie schon in der Nacht vom 27. zum 28. August Lärm in der Wohnung gehört habe.
„Ich leide an Schlaflosigkeit. — Der 27. August bedeutet für mich ein besonderes Ereignis — eine Jugenderinnerung —“ sie macht eine kleine Pause —, „ich weiß also, daß es die Nacht vom 27. zum 28. August war, da hörte ich deutlich ein Möbelstück fallen, dann die Stimme einer Frau und eines Mannes. Und die Nacht darauf, vom 28. zum 29. August, vernahm ich einen Schrei. Aber ich habe ihm, obwohl ich sehr erschrocken war, keine weitere Bedeutung beigemessen!“
Die Gräfin Scudellari wird gemeldet.
Der Polizeiinspektor geht ihr entgegen, will sie schonend über das Verbrechen, dem ihr Vetter zum Opfer gefallen ist, aufklären. Aber sie weiß schon alles. Sie ist sehr blaß, erregt, doch bleibt sie seltsam kühl, will den Toten nicht mehr sehen und bedauert in bewegten Worten die Witwe und die beiden Kinder, die der Tote hinterläßt. Den Beamten fällt diese Teilnahmlosigkeit auf, sie beobachten die Gräfin. Eine Frau von vierzig Jahren, schon etwas stark geworden, eine interessante Erscheinung mit großer, edler Nase und guter Haltung, kann sie noch immer für schön gelten. Aber der wohl einmal lebensfreudige Mund hat eine seltsame Starre, die Pupillen sind erweitert wie unter der Einwirkung von Belladonna. Alles in allem das Antlitz einer Aristokratin, doch nicht ohne Geheimnisse. Der ironische Mund scheint sich über die Beamten lustig zu machen. Sie weiß nichts Neues zu sagen. Ihrer Meinung nach ist es ausgeschlossen, daß vor dem 28. August Leute in der verschlossenen Wohnung waren.
„Sie brauchen nicht weit zu suchen, meine Herren! Die Korrespondenz des Grafen wird Ihnen genügend Aufklärung geben!“
„Sie glauben also auch, Frau Gräfin, daß ein galantes Abenteuer der Hintergrund dieser Tragödie war?“
„Was sonst? Nur eine derartige Affaire! Mein Vetter hatte sich durch seine Torheiten viel Sympathien verscherzt.“
„Sie sind mit der Frau Gräfin Martini befreundet?“
„Sehr!“
Der Inspektor beendet die kurze Aussprache mit einer Verneigung. Die Gräfin wirft einen kurzen Blick durch halbgeschlossene Augen ins Arbeitszimmer, wo die Leiche unter dem Teppich liegt. Der Kommissar beobachtet sie. In seinem kalten Gesicht ist nicht zu sehen, welche Gedanken ihn bewegen.
Unten wartet schon der Wagen, die Leiche zu überführen. Vom Gericht ist Richter Castel gekommen, von den Beamten ehrerbietig begrüßt. Er hat keine Funktion hier, nur Berufsinteresse hat ihn an den Schauplatz dieses Verbrechens getrieben. Er geht stumm umher, den runden Stockgriff gegen das Kinn gepreßt, alles beobachtend, mit dem steinernen Blick der Gorgo.
Irgendein Gedanke treibt ihn von Zimmer zu Zimmer. Vor dem Bildnis der Gräfin Martini bleibt er stehen. Ein unbekannter Künstler hat es gemalt, aber er hat den Ausdruck der jungen Frau überraschend getroffen. Ein Mädchen blickt aus dem Rahmen herab, ein zartes Mädchenantlitz, rührend in einer leidenden Zärtlichkeit, die mit schwärmerischen großen Augen sich dem unbekannten Leben hingibt, mit dem Wissen um das Leiden des Weibes.
Richter Castel zeigt bei der Betrachtung dieses Bildes keine Bewegung. Sein regelmäßiges Gesicht bleibt starr wie eine Maske, seine Augen sind überschattet von den starken Brauen, die sich langsam zusammenziehen, bis sie einen einzigen drohenden Strich bilden, eine schwarze Warnung. Sein geschliffener Mund, eine Degenklinge in rhetorischen Duellen, der Mund eines Asketen, an dem zurückgehaltene Leidenschaften um Entfesselung ringen, zieht sich spitz zusammen und verrät Hohn, Ablehnung, Haß.
Inzwischen ist es Richter Castell entgangen, daß die Beamten, eigentlich Leutnant Sonzo, eine wichtige Entdeckung gemacht haben, die für die Ermittlungen den Kriminalisten das bedeutet, was der Schöpferrausch dem Dichter ist, für den Diplomaten die Schwäche des Gegners:
Die Spur.
Sonzo hat unter dem Teppich im Mordzimmer einen zerknitterten Zettel gefunden. Er lautet:
„Für fünfhundert Lire ärztliche Instrumente in Pfand genommen.
Strozzi.
Bologna, 20. August.“
Die Bestätigung ist mit kräftiger Handschrift niedergeschrieben.
„Strozzi“, sagt der Kommissar. „Unbekannt. Einen solchen Pfandleiher gibt es in Bologna nicht.“
„Wir müssen ihn in den Kneipen suchen“, erwidert der Inspektor. Sein Fingernagel deutet auf zwei Worte auf der Rückseite. Der beschmutzte Zettel ist das Stück einer Speisekarte. Uova con — das Weitere ist abgerissen. „Soll heißen: Uova con prosciuto, Eier mit Schinken. Hektographiert! Ein kleines Restaurant also.
Meine Herren, wir haben die Spur des Verbrechers.“
3.
Am Abend des 24. August, zwei Tage also vor der Abreise des Grafen Martini aus Venedig, war es zur letzten Auseinandersetzung zwischen ihm und seiner Gattin gekommen.
Die Szene war so furchtbar, daß Ferdinand Pichi, der Kammerdiener, schreckensbleich nach dem Schlafzimmer der Gräfin stürzte, um ihr zu Hilfe zu kommen. Aber vor der Tür blieb er stehen. Sie war angelehnt, man konnte jedes Wort im Korridor verstehen. Frieda, die Köchin, stand in einem Winkel, Adele, die Zofe, war zu den weinenden Kindern geeilt.
Der Graf war, von einigen angezechten Freunden begleitet, nach Hause gekommen. Vor dem Tor des alten Palazzo hatten sich die Freunde verabschiedet.
Mit schweren Schritten war Francesco Martini die Marmorstufen emporgestiegen. Dieser Palast stammte, wie so viele andere aus der Umgebung des Canal Grande, noch aus den Glanzzeiten der venezianischen Adelsgeschlechter. In den mächtigen Räumen des Inneren versanken förmlich die Menschen, wie die Jahrhunderte in ihnen versunken waren. Nur die Schatten blieben …
Vor dem Gemach der Gräfin blieb Martini stehen.
„Maria“ — er klopft an die schwere Eichentür — „Maria, schläfst du?“
„Nein, Francesco“, tönt die helle Stimme der Gräfin zurück. „Schlafe wohl! Buona notte!“
„Der Teufel soll — —“ brummte Francesco. Und laut: „Öffne, angelo mio!“
„Nein, Francesco, ich bin müde!“
„Aber meine Liebste! Carissima! Nur ein paar Minuten! Ich möchte noch mit dir plaudern!“
Die Gräfin stand vor dem großen Spiegel. Sie trug bereits ihr seidenes Nachtkleid, an den kleinen Füßen bunte Pantoffel. Eher klein als groß, glich sie nicht den norditalienischen Frauen, von denen die Turinerinnen die schönsten sein sollen. Das zarte Gesicht ist nur Hintergrund für die großen, ovalen Augen.