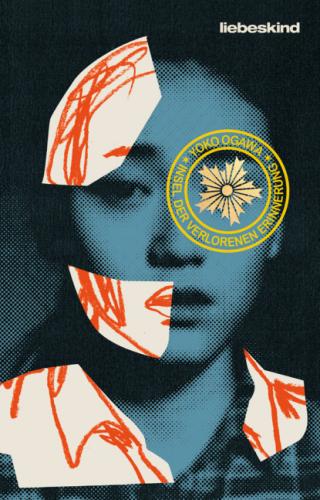Die Glühlampe war mit Staub bedeckt, und das matt schimmernde Licht ließ die Szenerie im Atelier wie ein Aquarell erscheinen. Ein paar verwaiste Dinge schlummerten in den Ecken: eine unvollendete Skulptur, ein vergilbter Skizzenblock, ein völlig vertrockneter Wetzstein, eine kaputte Kamera, eine Schachtel mit Pastellkreiden. Bei der geringsten Bewegung knarrten die Stühle. Draußen war es stockdunkel, der Mond war nirgends zu sehen.
»Mmh, lecker«, sagte der Kleine und schaute in die Runde, offenbar verwundert darüber, dass keiner von uns ein Wort sprach. Er hatte einen Milchbart.
»Ja, das schmeckt gut.«
Wir alle nickten ihm zu.
Ich hatte keine Ahnung, was ihnen bevorstand, aber zumindest konnten sie sich jetzt in diesem Augenblick an der warmen Milch erfreuen.
»Wo ist denn Ihr Unterschlupf?«
Die Frage brannte mir auf der Seele.
»Vielleicht kann ich Ihnen behilflich sein. Ich könnte Ihnen Sachen zukommen lassen, die Sie brauchen, und Nachrichten übermitteln.«
Die Eheleute schauten sich kurz an und senkten dann gleichzeitig den Blick. Nach einer Pause betretenen Schweigens sagte der Professor: »Es ist sehr freundlich, dass Sie sich um uns sorgen. Ich denke jedoch, es ist besser, wenn Sie nichts über unser Versteck wissen. Das soll nicht heißen, dass wir befürchten, Sie könnten unser Geheimnis verraten. Sonst wären wir kaum gekommen, um Ihnen die Skulpturen zu bringen. Aber wir möchten Sie nicht in Schwierigkeiten bringen. Je mehr Sie involviert sind, desto gefährlicher wird es für Sie. Angenommen, die Polizei würde Sie verhören. Dann können sie nur so viel aus Ihnen herausbekommen, wie Sie tatsächlich wissen. Aber wenn die Männer den Verdacht hegen, dass Sie mehr wissen, als Sie zugeben, dann werden sie keine Rücksicht nehmen. Fragen Sie also bitte nicht weiter nach unserem Verbleib.«
»Das verstehe ich. Auch ohne Ihren Aufenthaltsort zu kennen, werde ich für Ihr Wohlergehen beten. Gibt es noch etwas, was ich für Sie tun kann?«
»Ja, können Sie mir vielleicht eine Nagelschere bringen? Seine Fingernägel sind so lang geworden«, sagte Frau Inui leicht verlegen und griff nach der Hand ihres Sohnes.
»Aber natürlich.« Ich suchte in einer der Schubladen nach der Schere. Dann zog ich ihm die himmelblauen Handschuhe aus. »Halt still, es ist gleich vorbei.«
Seine Finger waren zierlich und makellos. Ich kniete mich vor ihm hin und nahm vorsichtig seine Hand. Der Junge schenkte mir ein schüchternes Lächeln und baumelte mit den Beinen.
Mit dem kleinen Finger der linken Hand beginnend, schnitt ich ihm behutsam die Nägel. Es ging ganz leicht, die durchsichtigen Halbmonde fielen wie Blütenblätter zu Boden. Wir alle lauschten still dem leisen Knipsen. Es waren zarte Töne, die in tiefster Nacht diesen Augenblick besiegelten.
Die hellblauen Fäustlinge warteten geduldig auf dem Tisch, bis die Prozedur beendet war.
Dann verschwand die Familie Inui.
6
Ich stieg die Treppe hinauf. Sie war so schmal, dass man fürchten musste, nicht aneinander vorbeizukommen, falls jemand zur gleichen Zeit nach unten wollte. Die Stufen bestehen lediglich aus unbehandelten Holzdielen, ohne Läufer und Geländer.
Jedes Mal wenn ich die Stufen erklimme, habe ich das Gefühl, in einem Leuchtturm zu sein. Ich bin nur zweimal in meinem Leben auf einem Leuchtturm gewesen, aber irgendwie waren der Klang meiner Schritte und der Geruch hier ähnlich. Der dumpfe Laut, wenn man auf einen Spalt zwischen den Dielen trat, und der Geruch von Maschinenöl.
Der Leuchtturm aus meiner Kindheit sandte schon lange kein Licht mehr aus. Kein Erwachsener wagte es, ihn aufzusuchen. Die Landspitze, auf der er stand, war dicht mit Schilf bewachsen, so trocken und spitz, dass man sich die Beine aufschnitt.
Ich war damals mit meinem älteren Cousin zum Leuchtturm gewandert. Er hat jede meiner Wunden abgeleckt.
Neben der Treppe befand sich eine kleine Kammer, der Ruheraum für den Leuchtturmwärter. Darin ein Klapptisch mit zwei Stühlen. Der Tisch war ordentlich gedeckt mit einer Teekanne, einer Zuckerdose, Servietten, zwei Tassen und Kuchentellern mit kleinen Gabeln daneben.
Der Abstand zwischen dem Geschirr, die Ausrichtung der Tassen, der Glanz der Gabeln – alles hatte eine Perfektion, die mir kalte Schauer über den Rücken jagte. Aber zugleich versuchte ich mir auszumalen, was für ein herrlicher Kuchen einst auf den blitzblanken Tellern serviert wurde.
Der Wärter hatte vor vielen Jahren schon den Turm verlassen, und das Leuchtfeuer, das früher über das Meer streifte, war kalt und verstaubt, aber hier in der Kammer hatte man das Gefühl, gleich würde sich jemand zum Tee an den Tisch setzen.
Als ich auf das Gedeck starrte, kam es mir vor, als würde ich heißen Dampf aus den Tassen aufsteigen sehen.
Nachdem wir einen Blick in die Kammer geworfen hatten, stiegen wir weiter die Treppe hinauf. Ich zuerst, mein Cousin dahinter. Die düstere Wendeltreppe wollte kein Ende nehmen, und wir fragten uns schon, wann wir endlich oben ankommen würden.
Ich war damals etwa sieben oder acht Jahre alt. Ich trug einen Rock mit rosafarbenen Trägern, den meine Mutter mir genäht hatte. Er war entschieden zu kurz, da half auch kein Verlängern der Träger. Ich hatte Sorge, dass mein Cousin hinter mir unter meinen Rock sehen konnte.
Aus welchem Grund waren wir damals den Leuchtturm hochgestiegen? So genau kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern.
Als wir schon ganz außer Atem waren, wurde plötzlich die Brandung lauter und es roch immer stärker nach Maschinenöl. Natürlich konnte ich damals den Geruch noch nicht einordnen. Zunächst hatte ich Angst, es wäre eine giftige Substanz, die uns körperlichen Schaden zufügen würde. Ich legte schützend die Hand vor den Mund und hielt die Luft an, was die Sache nur noch schlimmer machte. Mir wurde furchtbar schwindlig. Unten schepperte es laut, und ich bildete mir ein, Schritte zu hören. Nachdem der Leuchtturmwärter das letzte köstliche Stück Kuchen auf die Gabel gespießt und verspeist hatte, folgte er uns nun den Turm hoch, mit Biskuitkrümeln in den Mundwinkeln.
Ich wollte mich Hilfe suchend zu meinem Cousin umblicken, traute mich aber nicht. Was, wenn nicht er, sondern der Leuchtturmwärter hinter mir war? Schließlich hockte ich mich auf die Treppe, da ich gar nicht mehr wissen wollte, was mich dort oben erwartete.
Ich weiß nicht, wie lange ich dort saß. Rings um mich herum herrschte Totenstille. Sogar die Brandung war nicht mehr zu hören. Ich lauschte angestrengt, vernahm aber kein einziges Geräusch. Da war nur diese bedrückende Stille, die den ganzen Turm erfüllte. Ich fasste mir ein Herz und drehte mich vorsichtig um.
Weder der Leuchtturmwärter noch mein Cousin stand hinter mir.
Es ist merkwürdig, dass diese Treppe mich immer an den Leuchtturm erinnert, schließlich bin ich gekommen, um meinen Geliebten zu treffen. Eigentlich hätte ich die Treppe hochfliegen müssen, stattdessen erklimme ich langsam Stufe für Stufe und lausche auf den Klang meiner eigenen Schritte.
Ich bin oben, im Turmzimmer der Kirche. Das Glockenspiel erklingt zweimal täglich: um elf Uhr morgens und dann wieder um fünf Uhr am Nachmittag. Unten im Erdgeschoss gibt es einen kleinen Raum, wo die Werkzeuge zum Justieren des Uhrwerks aufbewahrt werden. Er hat etwa die gleiche Größe wie damals die Kammer im Leuchtturm. Das Uhrwerk selbst befindet sich natürlich ganz oben im Turm, aber so weit bin ich nie hochgestiegen. Mein Geliebter erwartet mich im mittleren Stockwerk, im Lehrraum, wo der Schreibmaschinenkurs abgehalten wird.
Nachdem ich viele Stufen erklommen habe, kann ich die Schreibmaschinen hören. Zögerliches Tastenklacken vermischt sich mit flüssigem Rattern. Wahrscheinlich sitzen die Anfänger zwischen den Fortgeschrittenen, die kurz vor ihrer Abschlussprüfung stehen.
Ob er gerade neben einer neuen Schülerin