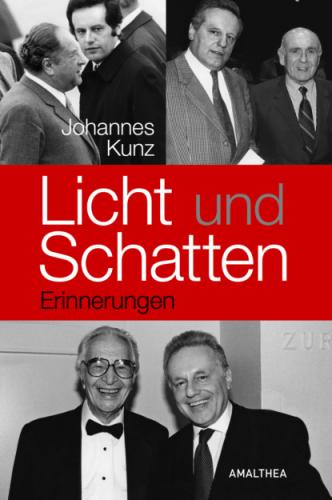Die Tschechen übernahmen nun die Macht und waren dabei, einen neuen Staat zu gründen. Eduard Beneš wurde wieder Staatspräsident und versuchte, die Tschechoslowakei zur unabhängigen »Brücke zwischen Ost und West« zu machen. Gegenüber dem kommunistischen Regierungschef Klement Gottwald (1896–1953) verlor Beneš nach den Wahlen von 1946 aber immer mehr an Einfluss und trat nach dem kommunistischen Staatsstreich 1948 zurück. Meine Mutter erinnert sich an die unmittelbare Nachkriegszeit: »Die neue tschechische Regierung hielt sich infolge der Maßnahmen Hitler-Deutschlands, wie zwangsweise Umsiedlungen, Massenvernichtungen, insbesondere aber der Zerschlagung ihres Staates, für berechtigt, mit grausamer Härte gegen die Sudetendeutschen vorzugehen, von denen ein großer Teil 1938 Hitler zugejubelt hatte mit dem Ruf ›Heim ins Reich!‹. Sie mussten dafür bitter büßen. Die Ausweisung der deutschsprachigen Bevölkerung aus den osteuropäischen Gebieten wurde im ›Potsdamer Abkommen‹ mit der Bestimmung einer geordneten und humanen Durchführung gebilligt, leider nicht so gehandhabt! Ohne ein geregeltes Abkommen getroffen zu haben, wurde die Vertreibung der Sudetendeutschen, das heißt ihre Umsiedlung nach Deutschland, beschlossen und mit größter Brutalität durchgeführt, was zweifellos einen Verstoß gegen die Menschenrechte darstellte. Man hatte von den Deutschen gelernt und viele Methoden übernommen, mit denen diese gegen die Juden vorgegangen waren, von der Armbinde angefangen. Man kann aber ein Verbrechen nicht mit neuen Verbrechen ahnden oder gutmachen, ohne sich ebenso schuldig zu machen. Es war und ist mir noch heute unverständlich, wie es möglich war, dass sich ein Großteil der Sudetendeutschen derart verhetzen, verblenden und missbrauchen ließ.«
Meine Mutter ließ sich sogenannte »Repatriierungsscheine« in Lobositz und bei Schering ausstellen, die man einer antifaschistischen Kommission vorlegen musste, die nach erfolgter Prüfung einen Antifaschistenausweis in tschechischer und russischer Sprache ausstellte. Sie wurde Augenzeugin von Vertreibungen: »Die Kommissare erschienen gewöhnlich um Mitternacht oder um 5.00 Uhr früh und kämmten Wohnung für Wohnung durch. Es mussten alle verfügbaren Dokumente, Ausweise etc. vorgelegt werden, die allerdings häufig zerrissen wurden – aus reiner Schikane. Die Leute wurden auf die Straße geworfen, mitnehmen durften sie nur, was sie in den Händen tragen konnten, ein schnell zusammengerafftes Bündel, und auch das wurde ihnen manchmal noch weggenommen. Sie wurden dann auf einem Sammelplatz zusammengetrieben, in Züge, oft auch Viehwaggons, gestopft und über die deutsche Grenze befördert, wo sie dann dem Flüchtlingsschicksal ausgesetzt waren, mit allen Härten, die ein solches mit sich bringt. Viele gingen auf dem Transport zugrunde, andere in Konzentrationslagern ähnlichen Sammelbecken, wo sie oft zu Tode geprügelt wurden. Selbstverständlich waren unter ihnen, wie immer im Krieg oder während einer Revolution, viele Unschuldige, die nicht ›Heim ins Reich!‹ gebrüllt hatten, keine Nazis waren und niemandem etwas getan hatten.«
Am Abend des 21. Juli 1945 wurde ein älterer Mann auf dem Marktplatz von Aussig mit Peitschen traktiert. Bald darauf sah man eine große Blutlache. Eine Welle entfesselter Wut, berichtete meine Mutter, habe zu grausamen Morden an Deutschen geführt: »Die Elbebrücke, die Verbindung nach dem Ort Schreckenstein, wo sich die Schicht-Werke befanden, war auf der Aussiger Seite abgesperrt worden. Als unzählige Arbeiter und Angestellte die Brücke betraten, um sich auf den Heimweg von der Fabrik zu begeben, wurden sie kaltblütig in die Elbe geworfen. Nur wenige konnten sich retten. Diese Begebenheit hat mir restlos die Augen geöffnet, ich erkannte, dass es keine Möglichkeit mehr für uns gab, in unserer alten Heimat ein normales Leben zu führen. Ich wollte auch in einem Staat, in dem sich Dinge wie die eben geschilderten abspielen konnten, nicht leben.«
Also erklärte das Ehepaar Ilse und Franz Kunz meiner Großmutter Melitta Beck, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um von Aussig wegzukommen. Mein Onkel Walter kam aus Wien und wollte versuchen, Einreise- und Aufenthaltsbewilligungen in Österreich zu beschaffen. Was nun folgte, war ein behördlicher Hürdenlauf. Doch die Reise nach Österreich sollte letztlich gelingen. In Wien wollten sich meine Eltern eine neue Existenz aufbauen.
Im vierfach besetzten Österreich hatten wenige Tage vor dem Eintreffen meiner Familie, am 25. November 1945, die ersten freien und demokratischen Nationalratswahlen seit 1930 stattgefunden. Die neu gegründete ÖVP erhielt 85, die SPÖ 76 und die KPÖ 4 Mandate. Das Ergebnis war für die Kommunisten eine schwere Enttäuschung, es wurde eine Drei-Parteien-Regierung unter Bundeskanzler Leopold Figl (ÖVP) gegründet. Er löste Karl Renner (SPÖ) ab, der Chef einer provisorischen Regierung war. Der neu gewählte Nationalrat bestimmte am 20. Dezember 1945 Karl Renner zum Bundespräsidenten.
Die erste Nachkriegs-Gemeinderatswahl in Wien brachte folgendes Resultat: SPÖ 58, ÖVP 36 und KPÖ 6 Mandate. Theodor Körner wurde Bürgermeister.
Seit Mitte 1944 war Wien insgesamt 52 Mal von starken Kampfverbänden angegriffen worden. Zuletzt wurde am 13. März 1945 die Innenstadt massiv bombardiert, Staatsoper und Burgtheater wurden schwer getroffen. Als der Zweite Weltkrieg zu Ende war, registrierte man die totale Zerstörung von 36.851 Wohnungen, weitere 50.024 Wohnungen hatten schwere Schäden erlitten. Somit war ein Fünftel des gesamten Wohnungsbestandes verloren. Man zählte 120 zerstörte Brücken, 3700 Schadstellen an Kanalisation, Wasser- und Gasnetz sowie rund 3000 Bombentrichter in den Straßen. Die Wiener Straßenbahn hatte zwei Drittel ihrer Wagen eingebüßt. Rund 11.000 Zivilisten waren während der Kampfhandlungen ums Leben gekommen, 35.000 Wiener waren obdachlos geworden.
Das Ausmaß der Zerstörungen kannte meine Familie natürlich noch nicht, als sie gegen 5.00 Uhr früh mit einem Möbelwagen vor dem Haus Brucknerstraße 4 im 4. Bezirk, der Wieden, eintraf. Hier wohnte Onkel Walter in Untermiete bei Frau Nimhin. Deren Haushaltshilfe Joscha zeichnete sich durch exzellente Kochkünste aus, die sie trotz größter Not an Lebensmitteln demonstrierte. Bald zogen meine Eltern zu einem Freund namens Rolf in die nahe gelegene Wiedner Hauptstraße, Großmutter Melitta blieb mit Onkel Walter bei Frau Nimhin in der Brucknerstraße 4.
In dieser schwierigen Situation, die von Not geprägt war, folgte eine sehr positive Überraschung. Per Post kam eine große Lebensmittelsendung, bestehend aus Mehl, Grieß, Zucker, Mohn …, an. Die Kiste wog 18 Kilo. Geschickt hatte sie aus Dankbarkeit das junge tschechische Ehepaar, das meinen Eltern in deren Aussiger Wohnung nachgefolgt war. Meine Mutter war gerührt: »So willkommen uns diese kostbaren Lebensmittel waren, nicht sie waren es, die uns alle so beeindruckt haben. Es war die Geste, die Menschlichkeit in einer unmenschlichen Zeit, in der auch der Stellenwert deutsch-böhmischer Flüchtlinge ein äußerst geringer war. Sie hat mich einmal mehr gelehrt, niemals zu verallgemeinern, nie alles in einen Topf zu werfen! Derartige Erfahrungen haben meine liberale Weltanschauung begründet und gefestigt. Ich werde stets Globalverurteilungen ablehnen, ebenso wie Vorurteile.«
| 7 | Meine glückliche Kindheitin Döbling | |
Weihnachten 1945 im zerstörten Wien: An Geschenke konnten meine Eltern nicht denken, man bekam ja nichts Vernünftiges, und Geld hatten sie auch keines. Immerhin gelang es, einen kleinen Christbaum zu beschaffen mit ein paar Kerzen, und meine Großmutter brachte etwas Gutes auf den Tisch. Man feierte in Rolfs Wohnzimmer, er selbst war nicht in Wien. Da es keine Heizung gab, war man in Jacken und Mäntel gehüllt.
Bereits vor Weihnachten hatte sich meine Mutter an ein Wohnungsbüro gewandt. Sie wollte unbedingt die Sowjetzone verlassen. Dieses Wohnungsbüro gehörte einem liebenswürdigen älteren Herrn, Oberstleutnant Zwilling, dem Vater des berühmten Afrika-Forschers Zwilling. Dieser machte bald die Mitteilung, er habe eine »unbewirtschaftete«, weil große und bombengeschädigte, Wohnung im 19. Bezirk in der Reithlegasse 6. Schon um die Wohnung besichtigen zu dürfen, benötigte man die Befürwortung der zuständigen Alliierten Kommission, in diesem Fall der Amerikaner. Auch das gelang meiner Mutter: »Beschwingten Schrittes eilte ich nach Hause,