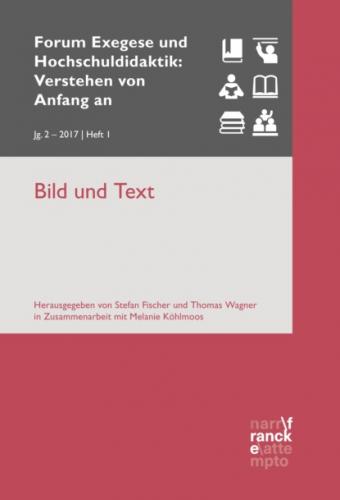Die ägyptischen Künstler und ihre Auftraggeber hatten offensichtlich kein Problem, unterschiedliche Perspektiven in ein Bild einfließen zu lassen. Das Bildwerk wurde in einem Guss hergestellt und beinhaltet doch zahlreiche Facetten, die für ein rein perspektivisch geschultes Auge nicht ohne Weiteres in Einklang zu bringen sind.
Umzeichnung ÄFig 1998.4 (Kalksteinrelief 31,5 x 19 x 5,4 cm), Datierung: Ramses II. (1279–1213a) © Stiftung BIBEL+ORIENT Fribourg
Wandmalerei S. 14354 /15 RCGE 19072 01/00000986 (131,4 x 211 cm), VII-XI. Dynastie (2118–1980a), © Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino
Methodische Konsequenzen aus den bildlichen Befunden
An dieser Stelle hat eine methodische Reflexion einzusetzen, die sich am ägyptischen Befund im Rahmen einer Mediengeschichte (zwischen Text und Bild) abarbeiten muss.1 Texte und Bilder sind, wie oben erwähnt, integraler Bestandteil der medialen Äußerungen der antiken Kulturen. Aus diesem Grund können methodische Einsichten der Text- oder der Bildinterpretation gegenseitig mit Ertrag aufeinander bezogen werden.2 Im skizzierten Beispiel (s.o. Abb. 1) wird deutlich: In einer bildlichen Darstellung, die in sich selbst keine substantielle Diachronie aufweist, können unterschiedliche Blickpunkte – so zum Beispiel auch Aufsicht (Vogelperspektive) und Ansicht (von der Seite) miteinander verbunden werden. Das bekannteste Beispiel einer solchen aspektiven Darstellung ist der mit Satteltaschen bepackte Esel (Abb. 2). Hier wird (grob gesprochen) die Seitenansicht des Tierkörpers mit der Vogelperspektive auf die Satteltaschen (von oben) kombiniert. Dreidimensional betrachtet ragen die Taschen nicht über den Rücken hinaus, sondern hängen an der Rückseite herab: Nicht-Sichtbares wird konzeptionell sichtbar gemacht. Dies wird in der Antike keinesfalls als Kohärenzstörung3 empfunden – jedes ägyptische Bildnis und viele orientalische Abbildungen verwenden diese Konvention ganz selbstverständlich. Vollkommen anders stellt sich die Sachlage in der Exegese biblischer Texte im 20. und 21. Jahrhundert dar. Hier werden Veränderungen der Perspektiven, Kombinationen unterschiedlicher Ansichten und Wechsel (von Personen, Standpunkten und Themen) als hochrelevante Kohärenzstörungssignale gedeutet.4 Sie zeigen angeblich an, dass ein diachrones Wachstum vorliegt und eigenständige, separate Teilstücke in einem Redaktionsprozess zusammengefügt würden. Mit welchem Recht wird so verfahren? Grundlage einer solchen Folgerung ist ein anachronistisches Verständnis des Textbegriffes, der mitunter deutlich von den antiken mediengeschichtlichen Grundlagen abweicht. Gerade die Kombination mehrerer Ansichten birgt einen Mehrwert, der planvoll schon auf synchroner Ebene Anwendung findet. Auch im Zweistromland – schon vor 4500 Jahren – war die aspektive Darstellungsweise verbreitet (Abb. 3): Seitendarstellung ist für die Köpfe und Beinpartien erkennbar, Augen und Brust-/Schulterbereich sind frontal dargestellt. Dass diese Einsicht auch für die biblische Literatur in Anschlag zu bringen ist, legt eine genaue Untersuchung der einzelnen Kapitel und Buchfolgen in der Hebräischen Bibel nahe.5 Schon zu Beginn des Kanons wird ein erster Schöpfungsbericht mit einem zweiten weitergeführt. Diese beiden lassen sich in inhaltlicher Hinsicht nicht perspektivisch in Einklang bringen.6 Vielmehr sind die vorgestellten Konzepte auf den ersten Blick zu unterschiedlich, als dass sie ein kohärentes Ganzes ergeben könnten. Wie müsste aber mit diesem Befund umgegangen werden, wenn nach ägyptisch-altorientalischem Vorbild das vorliegende Bauprinzip die Aspektive wäre? Entsprechend könnte eine Version des Schöpfungsberichts als Aufsicht, die andere möglicherweise als Ansicht charakterisiert werden. Mit einem Abgleich im Rahmen der antiken Medienbefunde schwindet die Schärfe des bisherigen Kriteriums zum Nachweis einer Kohärenzstörung. Mit anderen Worten: Es ist nicht zwingend nötig, die Beiträge zur Schöpfungstheologie, die Gen 1 und 2 darstellen, relativ-chronologisch weit auseinanderzuschieben, nur weil die beschriebenen Ansichtsschilderungen voneinander abweichen.7 Näher am Befund von Gen 1f. wäre eine Charakterisierung als ‚aspektive Annäherung‘ an ein Phänomen/Ereignis, das hinreichend komplex betrachtet werden muss, um ihm literarisch-künstlerisch (bzw. medial) gerecht zu werden. Ähnliche Situationen lassen sich für die Fluterzählung der Urgeschichte (Gen 6–8), das mehrfache Aufgreifen des Schilfmeer-Stoffes (Ex 13–15) und der Debora-Erzählung (Ri 4f.) attestieren. Einen neutestamentlichen Ankerpunkt findet die Idee von einer additiv holistischen Annäherung in der Überlieferungssituation der vier Evangelien.8 Mit guten Gründen kann behauptet werden, dass hier unterschiedliche Perspektiven auf ein wesentliches Ereignis im Hintergrund stehen: das Leben, Leiden, Sterben und die Auferstehung Jesu von Nazareth, der sich als der Christus erweist. Gerade um diesem komplexen Gegenstand literarisch Ausdruck zu verleihen, bedurfte es möglicherweise mehrerer Perspektiven, die nicht unmittelbar ineinander überführbar sind (Tatians Diatessaron und die apokryphe Evangelienliteratur liefern eindrückliche Beispiele für das Ringen um eine verlässliche theologische Position). Es ist folglich von großer Bedeutung, neben einer Wahrnehmung diachroner Indizien stets die methodische Rückfrage nach der Darstellungsweise und den zu Grunde liegenden Parametern in Text und Bild zu stellen. Unterbleibt dies, können diachrone Fehlinterpretationen den Blick auf eine facettenreiche künstlerische Kompositionstätigkeit9 verstellen. Der Exeget, der sich in erster Linie als Anwalt des Textes zu verstehen hat, kann solcher Art basale Fundamente der medialen Äußerung nicht einfach außer Acht lassen. Geschieht dies trotzdem, sind methodische Schieflagen vorprogrammiert (Florian Lippke).
Umzeichnung einer Reliefplatte aus Girsu (Tellō, Tell K), H 40; B 47, Paris, Louvre, AO 2344, Datierung: FD III/Ur I-Zeit (≈2500a), © Stiftung BIBEL+ORIENT Fribourg
Bilder verstehen heißt, Bilder in ihrer spezifischen Ausprägung zu sehen
Die Bildwelt, die der ägyptisch-orientalischen Kultur entspringt, ist aufgrund der unterschiedlichen lokalen Gegebenheiten und Traditionen sehr breit. Mit Bildern vermittelten ihre Produzenten mehr als das, was auf den ersten Blick zu sehen ist. So erfordert eine Deutung von Bildern eine genaue Beschreibung aller Aspekte, die mit der Bildproduktion und seiner Rezeption verbunden sind. Dies geht über die derzeit geläufige „vornehmlich deskriptiv-analytische Erforschung von Bildern und Bildkunst“1, die Gegenstand einer altorientalischen Ikonographie ist, hinaus. In Fortführung der Ikonographie fragt die Ikonologie nach Bildern als Symbolen einer Kultur. Sie untersucht die Bedeutung des einzelnen Bildes in seinem weiteren kulturellen Kontext. Neben einer ikonographischen Analyse setzt eine ikonologische Interpretation daher die „synthetische Intuition (Vertrautheit mit den wesentlichen Tendenzen des menschlichen Geistes)“2 voraus. Der symbolische Wert des Bildes wird als ein häufig unterbewusst in das Werk einfließender Faktor gewertet, der innerhalb der ikonologischen Analyse aufgezeigt und gedeutet wird. Erst durch diesen Prozess wird der eigentliche Gehalt des Bildes erkennbar.3 Dieser Ansatz basiert auf einer bewussten oder unbewussten Prägung des Künstlers durch seine Kultur, die in der ikonologischen Analyse aufgewiesen wird (Dokumentsinn4). Die Ikonologie basiert folglich auf der Vorstellung eines sich innerhalb einer Kultur erhaltenden Symbolsystems, das unter wechselnden historischen Bedingungen jeweils spezifische Ausformungen annimmt. Der ikonologische Ansatz ist also eine gattungskritische Beschreibung von Bildern, in der zuvorderst die jeweilige kulturelle Prägung des Künstlers untersucht wird.5 Damit ergibt sich zwischen Ikonographie und Ikonologie ein Spannungsfeld, das formkritisch beschrieben werden kann.
Im Spannungsfeld zwischen Ikonographie und Ikonologie wird die Wirkung des einzelnen Bildes und damit seine Funktion innerhalb des kulturellen Prozesses untersucht. Dieser formkritische Ansatz basiert auf der Annahme, dass der Künstler eine Wechselwirkung zwischen Bild und Betrachter im Bild bewusst anlegt. Eine solche Formkritik hat neben der Ausprägung des Bildes weitere Aspekte zu bedenken. Diese erweiterte Analyse setzt beim Motiv an. Dabei ist zunächst nicht die singuläre Ausprägung des Motivs entscheidend, sondern die dargestellte Szene (Konstellation). Die aus dem antiken Vorderen Orient überlieferten Bilder sind dahingehend unterschiedlicher