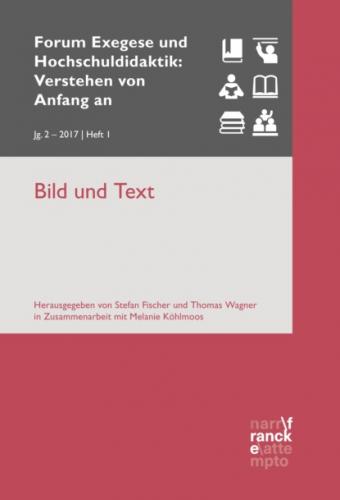Theologisch gewendet – und bei manchen Auslegern mit einer gewissen Prise Frömmigkeit angereichert – kann das Land, der (imaginäre aber auch der mit der Wirklichkeit in Bezug stehende) Raum, als ‚fünftes‘ Evangelium, als Schlüssel für die biblischen Texte verstanden werden.5
Heilige Schriften kreieren immer eine Welt, die durch den Text präsent ist. In diesem Sinne etablierte sich der Begriff der Textwelt6 gut. Jedoch kann an diesem Punkt beim Verstehensversuch nicht pausiert werden. Der Text weist immer auch eine Referenz auf. Diese Referenz gilt der antiken Welt, in der er produziert wurde. Archäologische, epigraphische, kulturgeschichtliche, ethnographische aber in besonderem Maße auch ikonographische Befunde spielen für diese Textreferenz eine große Rolle.7 Wesentlich ist für ein solches antikes Verständnis der Text- und Realwelten das Modell der verbundenen Kultursphären.
Die antiken Hochkulturen (Ägypten, Mesopotamien, Anatolien) sowie die kenntnisreichen Vermittler zwischen ihnen (Phönizier, Philister, Aramäer, ostjordanische Gruppen, Israel und Juda in Palästina/Israel) haben an diesem kulturellen Kontaktnetz einen großen Anteil.8 Wenn Assyrer/Babylonier mit Ägyptern in Kontakt traten, so zogen sie stets durch den Bereich der sogenannten ‚Levante‘.9 Wirtschaftliche Interessen bildeten meist die Grundlage. Mit ihnen wurden aber auch die jeweiligen sozialen, religiösen und kulturellen Aspekte im Land präsent. Auf diese Weise kann man von Palästina/Israel als einem Reservoir der antiken Konzepte sprechen: Unterschiedliche Weltvorstellungen, Menschenbilder und theologische Grundlagen liegen zur Rezeption bereit. In dieser Hinsicht steht die Kultur Altisraels auf hohen zivilisatorischen Schultern. Texte und Bilder geben von dieser Tatsache Auskunft und liefern ein beredtes Zeugnis für Transformationsprozesse und aktualisierende Tendenzen. Antike theologische Positionen sind somit in einem ganz entscheidenden Maße abhängig von den natürlichen, materiell-zivilisatorischen und kulturellen Rahmenbedingungen – und können bei Vernachlässigung dieser Aspekte nicht umfänglicher verstanden werden. Die genannten Mechanismen bewirken, dass die Hebräische Bibel ihrem Charakter nach ein orientalisch-ägyptisches Buch ist, das durch viele Übersetzungsprozesse hindurch immer noch die alten Vorstellungen bewahrte.
Schriftgeschichtlich lässt sich dieser Prozess von den komplexen Schriften der Hochkulturen (in Keilschrift und Hieroglyphen) hin zum genial vereinfachten System der Konsonantenschriften nachzeichnen.10 Bildlich zeigen die Rezeptionen von pharaonisch-ägyptischer und assyrisch-babylonischer Kultur das Zusammenkommen und die Überlappungen der imperialen Mächte in der biblischen Welt an.11 Und auch inhaltlich lässt sich dieses Modell bestätigen: Wenn im Buch Deuteronomium Phrasen verwendet werden, die im Wortlaut an die assyrischen Vasallenverträge anknüpfen, dann birgt dies eine Einsicht über die theologisch-ideologischen Einflüsse auf die biblische Welt in sich.12 Solche Verträge wurden in den Stadtzentren ausgestellt und die Schriftkundigen wurden damit konfrontiert. Eine Umformulierung des assyrischen Inhalts auf das Verhältnis zwischen Israel und seinem Gott stellt eine solche religiöse theologische Transformationsleistung dar. Den beschriebenen Facetten kommt man allerdings nur bei konsequenter Berücksichtigung aller zur Verfügung stehenden historischen Quellen auf die Spur.13 Neben Texten gehören darum auch Bilder, archäologische Erkenntnisse und kulturwissenschaftliche Einsichten zum Interpretationsprozess hinzu.
Teil 1: Methodische Annäherung
Aspektive – die Ausdrucksform Ägyptens und des Alten Orients
Präzision und Konstellation
Wenn das Verhältnis zwischen Texten und Bildern erforscht wird, so ist eine grundlegende Aussage immer häufiger als Ausgangspunkt in der Diskussion präsent: „Die Stärke des Textes ist die (historische) Präzision – die Stärke des Bildes ist die Konstellation.“1 Dies ist an einem einfachen Beispiel nachvollziehbar: Ein Text kann in beliebigem Maße historisch präzisieren. Datumsangaben und umfangreiche Details zur genauen Bestimmung sind ohne größeren Aufwand schriftlich integrierbar. Diese Präzision kann sehr weitreichend umgesetzt werden: In einem Roman wäre es möglich, jedem einzelnen Kopfhaar eine Bezeichnung zuzuordnen, zum Beispiel durch Namensgebung. Gleiches ist bei einem Bild nur sehr viel schwieriger durchführbar. Ein Bild besitzt immer auch Detailgrenzen, die nicht beliebig über- oder unterschritten werden können. Demgegenüber hat das Wort einen entscheidenden Mangel, wenn es um die Abbildungen von Verhältnissen zueinander geht. Eine Abbildung kann sehr gut verdeutlichen, wie zwei dargestellte Elemente zueinander im Verhältnis stehen. Dieses Verhältnis wird als Konstellation bezeichnet. Ein weiteres Beispiel kann dies verdeutlichen: Die extremste Form eines komplexen Konstellationsbildes ist ein Stadtplan.2 Hier werden auf jedem Zentimeter zahlreiche Verhältnisse unterschiedlicher Objekte zueinander festgehalten. Das Verhältnis einzelner Häuserblöcke, die Winkel, in denen Straßen aufeinandertreffen, Distanzen zwischen geographischen Punkten und Raumordnungen ganzer Quartiere – all dies begegnet in extrem verdichtetem Maß. Wenn man die Straßenkarte einer Großstadt komplett verbalisieren (verschriftlichen) wollte, müssten mehrere Buchbände mit Detailbeschreibungen gefüllt werden. Die Komplexität der Verhältnisse wird durch einen einzigen großen Stadtplan viel effizienter und nachvollziehbarer umgesetzt. In dieser Hinsicht wird die Stärke des Bildes, die in der Konstellation liegt, voll genutzt. Ein Text ist wiederum bei historischen Situationsbeschreibungen, die im Detail festgehalten werden sollen, im Vorteil.3
Umsetzung der Konstellation
Wenn also die Stärke des Bildes in der Konstellation liegt, dann ist es notwendig, genau auf die Umsetzung solcher Konstellationen zu achten. Es stellen sich folgende Fragen:
Auf welche Art werden Konstellationen künstlerisch ausgeführt?
Welche Besonderheiten sind zu benennen?
An welchen Stellen besteht die Gefahr, einer anachronistischen Fehlinterpretation zu unterliegen?
Um diese Fragen zu ergründen, muss genauer nach der Darstellungsweise antiker Bildnisse gefragt werden. Als Ausgangspunkt kann die ägyptische Reliefdarstellung dienen.1 In deutlicher Weise treten bei diesen bildlich-kulturellen Äußerungen Darstellungskonzepte hervor, die auch in vielen weiteren Zentren des Alten Orients über Jahrhunderte hinweg in Geltung waren.2 Genauer ist damit auf die Darstellungsweise Bezug genommen, die man gewöhnlicher Weise als ‚typisch ägyptisch‘ bezeichnet.
„Ägyptische“ Darstellungsweise (Abb. 1)
Reliefs, die in Ägypten, aber auch in den großen Museen der Welt1 bestaunt werden können, weisen mehrheitlich eine besondere Körper- und Objektdarstellung auf: Sie wirken auf den ersten Blick seltsam verdreht. Dies gründet in einem Abbildungskonzept, welches nicht mit den ‚perspektivischen‘ Grundsätzen der modernen Bildkultur in Einklang zu bringen ist.2 Folglich wird nicht ein einziger Standpunkt eingenommen, von dem aus ein Objekt betrachtet wird. Vielmehr stellt das Bild eine Addition unterschiedlicher Blickrichtungen dar. Einige Interpretatoren sehen hierin eine Addition der Ansichten, andere legen Wert darauf, dass das Objekt mit seinen Eigenheiten im Zentrum steht. Ein Merkmal dieser Darstellungen kann offensichtlich nicht bestritten werden: Als Fotografie im heutigen Sinne, von einem Standpunkt aus, wären diese Simultanansichten bezüglich des betrachteten Objekts nicht gesamtheitlich wahrnehmbar.3 Die Stärke der ägyptischen Bilder liegt also in einer besonderen Art der Komposition. Einzelne Ansichten werden in Zusammenschau aufeinander bezogen. Entsprechend kann im Bildnis einer Person auch ein mehrfacher Ansichtswechsel erfolgen.
Während die Beine von der Seite, in Schrittstellung, dargestellt sind, erscheint der Oberkörper in Frontalstellung, so dass beide Schultern und auch Details der Brust sichtbar sind. Die Arme setzen wiederum nicht in Frontalansicht am Oberkörper an, in ihrem Verlauf (von der Schulter zur Hand) werden sie eher in Seitenansicht angefügt. Während der Kopf insgesamt von der Seite, also im Profil, realisiert ist, bleibt das Auge aber komplett sichtbar. Bei einer vollkommenen Seitendarstellung würde das Auge nur als Winkel, partiell, erscheinen. Im klassisch-ägyptischen Fall aber tritt neben die Profildarstellung des Gesichts die Frontaldarstellung des Auges. Diese ständigen Wechsel zeigen an, dass es um mehr als nur um eine einfache Ansicht geht.