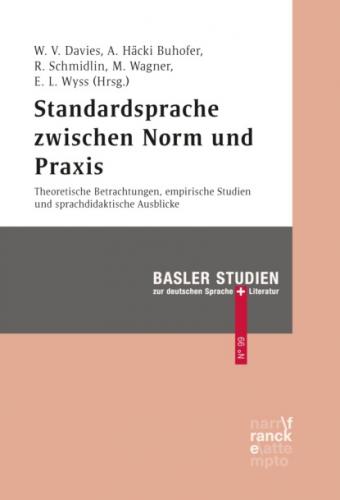III. Interdisziplinäre Zugänge
Karin Gehrer, Maren Oepke & Franz Eberle überprüfen, ob die für die Schweiz repräsentativen empirischen Daten der Studie EVAMAR II für die sprachwissenschaftliche Plurizentrik-Debatte innerhalb des Deutschen ein gewisses Analysepotenzial bieten und ob für sprachliche Leistungsunterschiede auf universitärem Niveau empirische Hinweise für den Einfluss der Familiensprache (bzw. der Familienvarietät) gefunden werden können. Es wird gezeigt, dass bei MaturandInnen aus einem Elternhaus mit Sozialisation in Schweizerdeutsch und Schweizer Standardsprache gegenüber MaturandInnen aus einem Elternhaus mit bundesdeutscher Standardsprache weder im Gesamttest noch in den einzelnen Subskalen (Grammatik/Orthographie, Leseverstehen, Wortschatz) signifikant voneinander abweichende Ergebnisse erzielt werden. Es existieren somit auf den ersten Blick keine auffälligen Sprachstandsunterschiede. Allerdings vermuten die AutorInnen, dass dies auch an den insgesamt hohen Hürden für das Gymnasium in der Schweiz liegt, die auf die Ausprägung der sprachlichen Fähigkeiten bereits selektiv wirken. Brisant sind dabei die grossen Unterschiede in den Leistungen zwischen den Schülerinnen und Schülern und das Defizit am unteren Ende der Leistungsskala.
Die Literaturauswahl, kanonisiert in Literaturgeschichten, orientiert sich traditionell – wie Stefan Neuhaus zeigt – an den geographisch-territorialen Grenzen eines gesamtdeutschen Sprachraums. Weder die Betonung von Frauen- noch von MigrantInnen-Literatur haben diese territoriale Dominanz der Kategorisierung brechen können. Neben nationalen (die Literatur von Österreich und der Schweiz ist von deutschen Literarhistorikern allzu gern zur ‚deutschen‘ Literatur gerechnet worden) sind regionale Perspektiven auf Literatur dazugekommen. Obschon aber nach 1945 die Nationalismen zurückgedrängt wurden und Literaturgeschichten dem Nationalismus abgeschworen haben, orientieren sich diese weitgehend an dem früheren, an staatlichen oder regionalen Grenzen orientierten Einteilungssystem. Die Literatur spielt im Identitätsdiskurs eines Landes nach wie vor eine zentrale Rolle. Neuhaus beschreibt eine seit dem 18. Jahrhundert laufende Entwicklung, die von der gewachsenen Bedeutung der Grenzen einer imaginären deutschen, österreich-ungarischen oder schweizerischen Nation über eine Auflösung des Nationalitätsdispositivs hin zu einer erneuten Stärkung der nationalen oder auch regionalen, in jedem Fall geographischen Komponente im gesellschaftlichen Diskurs führt. Dies sei z.B. an der gewachsenen Bedeutung von nationalen oder regionalen Literaturgeschichten, Literaturarchiven oder Literaturpreisen ablesbar.
IV. Sprachdidaktische Ausblicke
In seiner Pilotstudie zum deklarativen Wortwissen von Lehrpersonen zeigt Klaus Peter, welche Rolle Sprachbewusstheit und Sprachwissen der bewertenden oder korrigierenden Person beim Umgang mit sprachlicher Variation spielt. Das Sprachwissen ist einerseits als Bedeutungswissen und andererseits als enzyklopädisches Wissen konzeptualisiert. In Bezug auf die Erforschung von Bewertungen regionaler Varianten folgert Peter, dass eine umfassende Interpretation einer Variantenbewertung nur dann gelingen kann, wenn sowohl Daten zu den Spracheinstellungen als auch zum individuellen Sprachwissen (oder der individuellen Sprachbewusstheit) der bewertenden Person vorliegen. Seine Ausführungen zeigen somit einen Schwachpunkt vieler bisheriger Spracheinstellungsuntersuchungen auf; dass nämlich oft zu wenig unterschieden wird, ob einer Gewährsperson eine Variante bekannt ist oder ob sie gerade im Bereich der Semantik über volle Kompetenz im Sinne von Besitz von enzyklopädischem Wissen zu einem Wort verfügt oder nicht.
Einsichten in das Normverständnis von Schweizer Lehrkräften bietet der Beitrag von Adriana Gatta. Sie untersucht, wie Lehrpersonen auf der Sekundarstufe II mit Helvetismen in Aufsätzen verfahren, ob und wie die Lehrpersonen die Helvetismen korrigieren und wie sie diese bewerten. Die Auswertung erfolgt nach den aussersprachlichen Faktoren Alter, Ausbildung, Schulstufe und Unterrichtserfahrung der Lehrpersonen. Zwar zeigen sich jüngere Lehrpersonen etwas toleranter gegenüber Helvetismen als ältere, die anderen Faktoren scheinen auf die festgestellte Helvetismenskepsis jedoch keinen Einfluss zu haben (vgl. Davies in diesem Band, Wyss in diesem Band). Ein Effekt zeigt sich jedoch in Bezug auf die sprachliche Ebene der Variation; so wurden syntaktische Helvetismen am häufigsten korrigiert.
Einen kritischen Blick auf die Lernerlexikographie wirft Chiara Scanavino. Zunächst thematisiert sie Missverständnisse, die sich aus der gängigen Terminologie zur Beschreibung der Varianten und ihrer Positionierung gegenüber den Nicht-Varianten ergeben können (vgl. dazu schon von Polenz 1988), und schlägt bspw. für letzteren Fall interdeutsch anstelle von gemeindeutsch vor. Es folgt ein Überblick über die Darstellungsweisen von Teutonismen in Lernerwörterbüchern, wobei die Auto-Kennzeichnungen sowohl der österreichischen und schweizerischen Varianten als auch der Varianten der Bundesrepublik Deutschland von Scanavino für die Angemessenheit der lexikographischen Darstellung als wichtiges Kriterium betrachtet wird. Insgesamt bezeichnet Scanavino die Darstellung von Varianten der Standardsprache in Lernerwörterbüchern als noch nicht zufriedenstellend. Sie plädiert für eine stärkere strukturelle Orientierung an enzyklopädischen Wörterbüchern und fordert eine nestalphabetische Darstellung der Lemmata, wobei auch deren Frequenz und kontextuelle Einbettung berücksichtigt werden sollen.
Fazit und Ausblick
Der Blick auf den Entwicklungszusammenhang der deutschen Standardsprache, der den Auftakt des vorliegenden Bandes bildet, weist auf die historische Verankerung der Plurizentrik des Deutschen.4 Die deutsche Standardsprache wurde zwar als Kultursprache hypostasiert. Gleichzeitig kann ihre Einheitlichkeit für keine Epoche nachgewiesen werden. Welches Gewicht soll nun aber heute der nationalen Zugehörigkeit beigemessen werden, wenn es zur Kategorisierung der Varietäten der deutschen Standardsprache kommt? Die Beantwortung dieser Frage erweist sich deshalb als schwierig, weil erstens die nationale Zugehörigkeit historisch und kulturell zwar weiterhin sozial verankert ist, was sich etwa in der literarischen Kanonbildung noch immer nachweisen lässt, weil aber zweitens gleichzeitig Nationalismen als soziale Kategorien (zu Recht) hinterfragt werden und ihre Überwindung gefordert wird. Die soziokulturelle Wirkung national-territorialer politischer Grenzen bei der Beschreibung von Sprachvariation zu negieren, wäre unseres Erachtens aber der falsche Weg. Gerade in Bezug auf die Verwendung der deutschen Standardsprache zeigt sich die Wechselwirkung der statuierten und subsistenten Normen, die die Sprecherinnen und Sprecher nachweislich prägen, wodurch bestimmte Formen des Standardsprachgebrauchs weitertradiert werden, die sowohl national als auch regional erkennbar bleiben. Wenn nun Vertreterinnen und Vertreter des plurizentrischen Ansatzes, die biographisch meist selbst aus kleineren Zentren stammen, mit dieser Modellierung auch die ökonomische, sprachliche und diskursive Dominanz des bundesdeutschen Zentrums thematisieren, wird dies zuweilen als Aufbegehren der sprachlich Dominierten ausgelegt, das mit einem nationalistisch motivierten Variantenpurismus einhergehen kann. Dabei wird ausgeblendet, dass auch eine plurizentrische Modellierung der Sprachvariation Überlappungen von Merkmalen entlang verschiedener Kontaktzonen darstellen kann und die nationale Variationsdimension als eine neben anderen Variationsdimensionen verstanden werden kann.
Ziel dieses Bandes war es nicht, sich zwischen der rege diskutierten, einer stärker der Dialektologie verpflichteten pluriarealen Modellierung einerseits und der soziolinguistisch-institutionell argumentierenden plurizentrischen Modellierung andererseits zu positionieren. Vielmehr können die hier vorliegenden Beiträge zeigen, dass mit den pluriarealen resp. plurizentrischen Modellen nicht die deutsche Standardsprache mit ihren Varietäten erschöpfend erfasst werden kann, sondern dass sie sich besser oder schlechter eignen können, um bestimmte Repräsentationsformen der deutschen Standardsprache darzustellen: mündlich, schriftlich; lexikalisch, lautlich, syntaktisch; in Bezug auf ihre (schulische) Bewertung; in Bezug auf regionale oder überregionale Pressetexte; in Bezug auf literarische Sprache oder Schulbuchtexte; in der Lernersprache; in Lernerwörterbüchern. Dazu kommt die Heterogenität