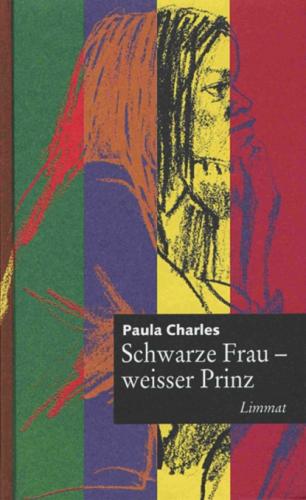Sie amüsierten sich, Jungs und Mädchen spazierten händchenhaltend dem Strand entlang. Sie packten ihre Getränke aus – ich hätte fürs Leben gern eine eisgekühlte Fanta gehabt. Sie packten ihr Picknickgeschirr aus: Porzellanteller, silberne Gabeln, nur für den Strand! Wir assen zu Hause meistens mit den Händen, und ich hätte gerne gewusst, wie es war, eine echte Silbergabel in den Händen zu halten.
Meistens sass unsere ganze Familie nahe am Ufer, aber dieses Mal waren Ben und ich allein. Aunties Kinder konnten alle schwimmen, wir wurden mit den Füssen im Wasser am Ufer zurückgelassen. Wir wuschen uns mit den Händen, gerade so, wie Granma es uns beigebracht hatte. Manchmal sprangen wir ins Wasser, obwohl wir uns vor den Wellen fürchteten und hofften, dass keine gefährlichen Fische unter unsere Füsse kamen. Mandy, die einige Jahre älter war, ihre Geschwister und ihre Freundinnen schämten sich wegen uns. Sie konnten den Gebräunten wenigstens zeigen, dass sie schwimmen konnten und nicht von den Bäumen kamen.
Da gab es einen Jungen, der meine Gedanken von Mandy ablenkte. Seine Haare waren tiefschwarz, er war gross und schlank, aber nicht zu mager, ganz mein Geschmack. Er kickte den Ball in unsere Richtung, zum Ufer hin. Er sah so unbeschwert aus, und ich wünschte, ich wäre wie er, hätte Eltern wie er. Ich hätte gerne mit ihm gespielt. Unsere Blicke begegneten sich, und ich wünschte, er würde mich umarmen. Ich hatte bereits die Figur einer jungen Frau, sah jedoch sehr naiv und sehr karibisch aus in meinem orangefarbenen englischen Bikini.
Mandys Geschrei ging mir durch und durch: «Paula, komm her!» – als ob sie meine Mutter wäre. Einige Minuten zuvor hatte sie versucht, mich zu ertränken. Sie wolle mich schwimmen lehren, hatte sie gesagt, und mich ins tiefe Wasser geführt. Ich schluckte Wasser. «Mandy, Mandy», schrie ich voller Panik, mit schreckgeweiteten Augen. Jeden Moment konnte es mit meinem jungen Leben zu Ende sein. Sie stand im tiefen Wasser und lachte mich aus. Ich tauchte unter, prustete, schlug aufs Wasser, strampelte mit meinem winzigen Körper nach allen Seiten. Sie hielt mich an meinen geflochtenen Haaren fest. «Du ertränkst mich», schrie ich. Sie schwamm um mich herum, drückte meinen Kopf unter Wasser. Alle schauten zu, ohne das Drama ernst zu nehmen. «Bitte, Mandy, lass mich!» Sie liess mich los. Ich stolperte ans Ufer. Es hatte nur einige Minuten gedauert, aber mir schienen es Stunden. Ich habe diesen Tag nie vergessen.
Da sie zwei Jahre älter war als ich, hatte sie das Recht mich zu schlagen, wie es ihr gefiel und wann sie wollte. «Was tust du da, Paula?» fragte sie, als sie auf mich zukam. Ich sass unter einer Kokospalme, mitten in der Schönheit Gottes. Die andern Kinder spielten mit jemandes Ball. «Was meinst du?» Ich zitterte ein wenig. «Haben wir dir nicht gesagt, du sollst keine Fremden anstarren und nicht mit ihnen reden!» Ich vermutete, sie wünschte sich, an meiner Stelle zu sein. «Ich habe mit niemandem gesprochen.» Sie schlug mir ins Gesicht: «Lüg mich nicht an! Ich habe dich gesehen.» «Er hat nur den Ball in meine Richtung gespielt.» Sie quetschte mein Ohr, machte klar, wer der Boss war, und hoffte, der gebräunte Junge sähe ihr zu. Ich fühlte mich beschämt und erniedrigt. Sie stiess mich vor sich her: «Nimm deine Kleider und geh in den Bus!» Ich hob meine ziemlich zerlumpten Kleider auf und setzte mich hinten in den Bus, während die andern sich amüsierten. Die Sonne brannte, Tränen liefen mir übers Gesicht. Ich hätte gerne nach meinem flüchtigen Freund gesucht, aber ich schämte mich, den Kopf zu wenden. Dann kamen Mandy und ihre Geschwister und Freundinnen. «Paula, was ist los mit dir? Warum weinst du?» fragte mein Bruder, der damals neun Jahre alt war. Ich erzählte ihm nichts, er hätte sie in Stücke gehauen, mit seinem Messer, so sehr hasste er sie und den Rest der Familie. Auch hatte er Granmas Tod nicht verwunden. Er war ein zorniger, karibischer Junge. In kürzester Zeit war der Bus voll. Die Fahrt war gut, aber ich wünschte, sie ginge in eine andere Richtung. Hatte er mich wirklich angesehen, oder war ich wieder in Phantasien? Wer weiss, vielleicht begegneten wir uns eines Tages wieder. Doch erst musste ich die Jahre des Nichtakzeptiertseins aushalten, bis zu dem Tag, an dem ich nach England zurückkehren würde. Wenn es doch nur so wäre!
Jungen und Mädchen blieben bei uns unter sich: Jungen spielten mit Jungen, Mädchen mit Mädchen, obwohl wir uns alle der Gefühle der anderen bewusst waren. Wir Mädchen kicherten, unsere Augen gross und glänzend vor Erregung. Wir sassen einander gegenüber, flochten lange Grashalme, sprachen im stillen einen Wunsch aus und liessen den Grashalm fliegen – hin zum auserwählten Jungen. Wir hofften, er würde kommen; manchmal klappte es, manchmal nicht. Jedenfalls gab es viele geflochtene Grashalme rund um unsere Schule.
Am Wochenende hatten wir meistens nichts anderes zu tun als zu träumen und zu grübeln, und wir Mädchen gingen saure Pflaumen oder Tamarinden pflücken. Die Tamarinde ist eine köstliche, süssaure Frucht mit einem länglichen Kern, die man pflückt, wenn sie braun wird. Wir lagen im Gras, saugten sie aus und warteten, bis die Sonne unterging.
«Paula», fragte Koretter, eine meiner Freundinnen, «was wünscht du dir, wenn du erwachsen bist?» Ich sass da, das Kinn in die Hände gestützt, und dachte lange und entspannt nach. Irgendwie konnte ich nur lächeln. Ich wusste nicht, womit beginnen und ob ich mich bei meinen Freundinnen gehen lassen sollte. Mit neun Jahren, nachdem Gran gestorben war, hatte ich gelernt, nie jemandem zu trauen, vielleicht nicht einmal mir selber. Und ausserdem wusste ich nicht, ob meine Wünsche nicht zu sehr Illusionen waren. Ich fühlte mich nicht als etwas Besseres, aber ich sah die Welt anders und wusste nicht, weshalb ich solche Gedanken hatte.
Meine St.-Lucia-Freundinnen hatten klare Träume ohne dunkle Streifen. Meine Träume jedoch hatten immer etwas mehr Szenerie und hellere oder dunklere Farben. Deshalb verriet ich ihnen nie meine Gedanken. Sie würden sie einfach nicht verstehen. Sie würden denken, ich wolle zuviel oder ich analysiere zuviel. Sie dachten nicht gerne zu genau über ihre Träume nach, die seit Generationen dieselben waren, von der Grossmutter an die Mutter weitergegeben. Ihre Träume waren nur ein bisschen realistischer als die der Vorfahren, weil es jetzt mehr Möglichkeiten gab, sie wahr werden zu lassen.
Koretter war ein Mädchen, das genau wusste, wohin sein Weg führte. Sie teilte allen ihre Träume mit. «Ich möchte meinen Schulschatz heiraten. Wenn er nur mit mir spazieren gehen würde, dann würde ich ihm von meinem Traum erzählen. Ich möchte seine Frau sein und ihm alles geben, was ein Mann sich wünscht, viele Kinder, ein Haus und einen Hof haben und zusammen alt werden.» Ich denke zurück an den Jungen, den sie im Auge hatte. Ja, er war schön – für sie, nicht für mich –, er war gross, aber er sah aus wie einer, dem eine Frau nicht genug war. Und überhaupt mochte ich seine Dreistigkeit nicht. Er hatte keine Manieren ihr gegenüber. Vielleicht wusste er, wie er ihr schmeicheln musste. Einige Frauen mögen es, wenn ein Mann grob ist, und er war grob. Sie war erst elf und lief ihm bereits hinterher. Ich hätte ihm am liebsten gesagt, er solle verschwinden, benahm er sich doch bereits wie ein König. Ja, er war ein kluger Kerl, er würde eine gute Ausbildung haben mit einem guten Verdienst. Aber sie würde mit ihm in die Hölle und in den Himmel geraten und wieder zurück. Und es schien mir, als hätte sie das bereits akzeptiert.
Wie konnte sie so bescheiden sein in ihren Träumen? Vielleicht, weil sie nirgendwohin konnte. Sie war, wo sie hingehörte, eine echte St.-Lucia-Frau. Sie war stolz auf ihr Land, auch wenn sie unter der Armutsgrenze lebte. Sie wusste, dass es ihre Bestimmung war, hier zu bleiben. Ich dagegen sah mich nicht als St.-Lucia-Mädchen, aber ich konnte ihr das nicht gestehen. Ich wollte weg, und sie sollte nicht wissen, warum. «Paula, hör auf zu sinnieren, es wird schon dunkel, meine Eltern werden mich suchen. Ich muss meine kleinen Schwestern waschen und zu Bett bringen.» «Koretter, ich weiss nicht, was ich träume. Ich müsste zu vieles erklären. Ich wünschte, ich wäre du. Wie kannst du dir nur so sicher sein?» «Ich bin sicher, das ist alles. Ich weiss, was ich will. Ich will nicht viel. Ich bin ein einfaches Mädchen.» Und was ist mit mir, fragte ich mich. Ich zuckte die Achseln, als wir den Hügel hinuntergingen. Es war sehr dunkel, nirgends ein Licht. Sie hatte keine Angst vor der Dunkelheit, ich jedoch schon. Warum wohl? Ich ging zu meiner Tante, und sie ging glücklich zu ihren Eltern.
Ich flirtete mit Jungs, träumte beinahe schon wie Koretter, doch es schien nie ganz zu gelingen. Warum war ich so unzufrieden? Was war falsch mit mir? Was wollte ich? Spielte ich, oder sah ich anders aus als meine St.-Lucia-Freundinnen? Stellte ich mich selber zu hoch? Oder war ich einfach ein Mädchen, das etwas wusste, was sie nicht wussten? Ich fühlte mich tiefgründig und etwas Besonderes – als ob ich aus irgendeinem