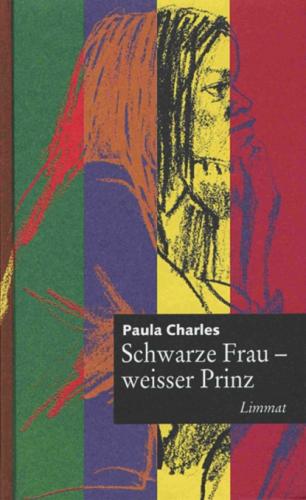Wir waren die einzigen im Dorf, die ein Radio hatten. So kamen alle zu uns, wenn Granma beschloss, sich etwas zu gönnen. Meistens jedoch waren die Batterien leer, und sie konnte sich keine neuen leisten. Wir versuchten beim Drehen der Knöpfe die Wörter zu verstehen, und es war ein grosses Wunder für uns, dass ein Mensch aus einer tragbaren Kiste heraus singen konnte. Es gab jeweils Streit zwischen uns Kindern, richtige Raufereien, weil wir nicht verstanden, wie das Radio funktionierte.
Wir hatten auch Mühe mit der Sprache, weil wir die meiste Zeit Patois sprachen. Wir gingen ja in die Dorfschule und erhielten nur das Mindeste an Bildung. Damals war mir nicht wirklich bewusst, dass wir arm waren. Es war soviel Hunger unter uns. Nicht nur nach Nahrung, sondern nach Tagen, an denen wir leben konnten, ohne zu sehen oder zu hören, dass jemand starb, weil keine Medizin zu bekommen war. Das einzige, was wir tun konnten, war beten.
Wenn ich Paul doch irgendwann einmal begegnen könnte, dachte ich. Ich wünschte, er würde nie aufhören zu singen und die Geschichte meiner Zukunft endlos wiederholen. Denn Granma würde das Radio vielleicht erst in einem Jahr wieder einschalten. Und dann brauchte sie Stunden, bis sie den Sender fand – falls sie ihn überhaupt fand. Wir durften das Radio nicht anfassen, durften höchstens, wenn wir Glück hatten, eines der wenigen in Ehren gehaltenen Geschenke polieren, die Vater ihr aus London geschickt hatte.
Für junge Mädchen in St. Lucia gehörte es sich nicht, Interesse an Jungs zu zeigen oder über sie zu sprechen. Dieses Thema war tabu. Sexuelle Gefühle wurden so sehr geheim gehalten, dass ich mich fragte, wie ich geboren worden war. Männer und Frauen zeigten einander nie in Gegenwart von Familie und Freunden ihre Gefühle. Irgendwie bedeutete dies Mangel an Respekt und eine zu grosse Ungezwungenheit. Dafür sprachen wir viel über die Kirche. Egal, wie du darüber sprachst, es war richtig und gesund. Wir sprachen über den nächsten Sonntag, wer im Chor singen sollte und was wir zur Kirche anziehen würden, zu welcher Frisur. Glaube an Gott und nicht an Sex!
Aber wie waren wir entstanden? Merkten die Erwachsenen nicht, dass es dafür immer zwei brauchte? Dass Sex Teil der schwarzen Rasse war, der menschlichen Rasse überhaupt? Nicht ein einziges Mal wurde über dieses Thema gesprochen. Was sie wohl heute von mir denken würden, wenn sie noch am Leben wären und wüssten, wie ich gelebt habe? Sie würden mich mit spiritueller Energie töten. Ich wäre erledigt, eine Schande für ganz St. Lucia.
Die Kirche hat viele der menschlichen Empfindungen verdorben, die Gott selber uns gegeben hat. Ich weiss nicht, welches ihre Idee von Gott und ihre Vorstellung von Moral war. Ich war eine eifrige Kirchgängerin, weil ich so erzogen worden war. Und insbesondere, weil wir arm waren, suchten wir nach einem neuen Weg zu einem besseren Leben. Wir hatten genug vom Leiden. Deshalb hiessen wir – wie überall in armen Ländern – die Missionare aus Europa mit dem wenigen, das uns geblieben war, willkommen. Doch durch sie wurden wir erst richtig arm. Sie nahmen unseren Zucker, unsere Baumwolle und unsere Früchte, unser Gold, unsere Diamanten und unsere Metalle und sogar unsere Natur und unsere Kraft. Wir glaubten ihnen dennoch.
Als ich ein kleines Mädchen war, so erinnere ich mich, suchten sie uns überall in den Dörfern. Es überraschte uns, dass sie unsere kleinen Dörfer überhaupt gefunden hatten. Meistens kamen sie in ihren besten Sachen, Kleidern und Autos. Viele von ihnen hatten die besten Häuser im besten Teil der Stadt. Aber wir waren zu naiv und hatten nicht genügend Wissen über diese christlichen Leute, um sie in Frage zu stellen. Und überhaupt, wer waren wir denn! In ihren Augen waren wir Bettler. Sie kamen, um uns Kraft zu geben, damit wir ihr Land reicher machten. Aber das wussten wir nicht. Wir nahmen alle so, wie sie waren. Wir wussten nicht, dass Missionare sehr gut ausgebildet waren – auch in Psychologie. Wir wussten nicht, dass sie unsere Kultur in Büchern studierten, bevor sie uns gegenübertraten. Wir fragten uns, wie sie überhaupt wussten, dass schwarze Menschen existierten. Sie waren für uns nette, andersartige, fremde Menschen, ihr Auftreten schien friedlich. Wir wussten nicht, dass sie sich bemühten, freundlich zu wirken, um uns ihre Bibel zu verkaufen.
Der Missionar kam zu uns. «Hello, Missis … em … Seewanese!» So hiess Granma offiziell, ansonsten nannte man sie Mades. Gran sass in ihrer kleinen Küche, mit ihren häuslichen Angelegenheiten beschäftigt. Mein Bruder und ich, ihre beiden Engel, waren an ihrer Seite oder zwischen ihren Beinen; wir klammerten uns immer irgendwo an sie. Sie zeigte dem weissen Christen ein grosses, breites Lächeln, als ob sie gerade Gott gesehen hätte. Oder war sie weiser? Wusste sie, dass sie betrogen wurde? «Willkommen», sagte sie zu ihm, «Paula, geh und hol einen besseren Stuhl für den Priester.» Der weisse Mann setzte sich und versuchte, es sich in Grans kleiner, stickiger Küche bequem zu machen. Er musste zumindest versuchen, sich wohl zu fühlen, wurde er doch von der Kirche dafür bezahlt, dass er die Leute überzeugte, die Bibel zu kaufen und ihre letzten Pennies der Kirche zu spenden.
Der Priester bemühte sich, eine Tasse von Grans Wasser zu trinken – Flusswasser, nicht chemisches oder, wie man es nannte, gereinigtes Wasser. Ihre einzige, schwarzbetupfte Tasse war etwa zehn Jahre alt und sah angeschlagen aus. Er hatte Diplomatie gelernt, also lächelte er und sagte, ihr Wasser sei genau das, was er gebraucht habe. Aber er wollte nur seine Botschaft verkaufen, dafür war er von weither angeflogen. Er wollte nicht wirklich ihre Armutsgeschichte hören und wechselte geschickt das Thema. «Also, Mrs. Seewanese, das Leben ist nicht allzu schlecht, aber Gott kann Ihnen mehr geben, wenn Sie zu ihm beten. Und deshalb sind wir hier, um Ihnen zuzuhören und mehr Kirchen bauen zu helfen, damit Sie dort um Hilfe beten können. Aber wir brauchen Geld.» Er öffnete seinen Koffer vor der sehr müden und verwirrten alten Lady, überreichte ihr Broschüren, die sie nicht lesen konnte, und viele schöne, glänzende Leder-Bibeln. Seine weisse Magie wirkte. Gran murmelte vor sich hin, schaute mit besorgtem Gesicht ihre Grosskinder an und dachte an die wenigen St.-Lucia-Dollars, die sie, in ein Tuch geknotet, versteckt hatte. «Was kann ich machen», sagte sie in Patois. Ihr Sohn war tot, ihre Tochter war tot, auch sie würde bald sterben, und was würde dann mit ihren kleinen Kindern passieren. Sie brauchte mehr Kraft, um uns durchzubringen. Der Priester hakte nach: «Mrs. Seewanese, es ist nicht viel Geld! Denken Sie an all die Hilfe, die Sie erhalten werden!» «Gut, ich kaufe.»
Ihre letzten paar Dollar lösten sich in Luft auf. Sie war wieder da, wo sie angefangen hatte, doch jetzt hatte sie sich mit diesem Buch Gott gesichert. Es blieb nun für immer an ihrer Seite – nicht so der Missionar. «Auf Wiedersehen, Kinder, bis bald in der Kirche», sagte er und schüttelte unsere kleinen Hände. Unsere Augen waren so weit offen wie seine Bibel. In diesem Moment war er für mich Gott. Er würde unser ganzes Leben verändern. Er sprang in seinen schweren Jeep, der speziell für unsere sandigen Strassen geeignet war, drehte die Scheibe hoch, während Ben und ich ihm die Autotüre aufhielten. Er drehte den Motor an, und das ganze Dorf rannte hinter ihm her, versuchte schneller zu sein als das Auto, das Staub auf unseren Gesichtern zurückliess. Das machte uns nichts aus: Ein englischsprechender weisser Mann war uns besuchen gekommen, weil er uns helfen wollte! Doch Grans Geld war weg. Und was würde geschehen, wenn sie krank wurde? Was war mit unseren Schulgeldern? Was, wenn wir hungrig waren? Lachte er auf dem Weg zurück in seine Paläste?
Sie machten Granma gar zur Kirchenältesten. So hatte sie zumindest das Gefühl, ihr würde geholfen. Doch sie benutzten nur ihre Kraft. Sie musste nach der Arbeit herumrennen, von der Farm und dem Dorf bis in die Stadt, um ihren eigenen Leuten für den weissen Mann das Wort Gottes zu verkaufen. Sie wusste nicht, dass sie sie reicher machte. Man erlaubte ihr nicht einmal, ihre Häuser zu betreten, weil sie nicht fein genug war, um mit ihnen zu essen. Sie war einfach eine aus dem Busch, und dort gehörte sie hin.
Granma blieb arm und wurde noch ärmer, aber sie wollte nicht zugeben, dass sie betrogen worden war. «Vielleicht braucht