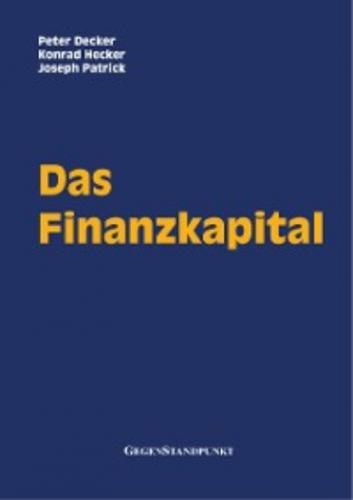c) Die widersprüchliche Errungenschaft: Staatliches Kreditgeld
Das nationale Kreditgeschäft ist die Quelle, sein Erfolg die ökonomische Rechtfertigung der Geldsummen, die in der Gesellschaft zirkulieren; nicht bloß der Zahlungsversprechen, mit denen die Banken ihre Finanzgeschäfte betreiben, sondern in Abhängigkeit davon, als Bestandteil ihrer Refinanzierung, auch des gesetzlichen Zahlungsmittels. Das ist im modernen Kapitalismus eben nicht mehr das vorgegebene feststehende Maß für Erfolg und Misserfolg der privaten Kredit- und Geldschöpfung, sondern Ausdruck dessen, was Banken und Geschäftswelt mit und aus dem darin bezifferten Eigentum machen. Sein Wert, das Quantum Verfügungsmacht, das es verbindlich repräsentiert, ergibt sich aus den Geschäften, denen das Bankgewerbe Geld als Vorschuss zukommen lässt, nämlich aus dem Verhältnis zwischen der Masse des als Vorschuss in Verkehr gebrachten Kredits und dem Wachstum der Zugriffsmacht des Kapitals, das damit zustande gebracht wird und rechtfertigen muss, was an Kredit in die Welt gesetzt worden ist.
Dass beide Größen nicht zusammenfallen, kann in einem System der Konkurrenz mit und um Kredit nicht verwundern. Es ist ja nicht nur so, dass es im Konkurrenzkampf kreditfinanzierter Unternehmen notwendigerweise Verlierer gibt, die ihre Schulden nicht bedienen können und ihre Kreditgeber zu ‚Wertberichtigungen‘ nötigen – das Geld ist weg und nicht weniger wert. Mit seiner Macht zu finanzieren, was sich zu lohnen verspricht, erbringt das Kreditgewerbe noch ganz andere Leistungen. Es agiert grundsätzlich rücksichtslos gegen die Schranken der Märkte, auf denen seine Kunden sich bereichern; sowohl, was deren Aufnahmefähigkeit für ein ständig gesteigertes Warenangebot angeht, als auch, was die Verfügbarkeit von Produktionsmitteln – einschließlich preiswerter Arbeitskraft – betrifft. Seine Kunden, ausgestattet mit der Macht fremden Geldes, behandeln ‚die Märkte‘ überhaupt als Quelle ihres Geschäftserfolgs, beanspruchen sie mit allen Mitteln für Einnahmen, die ihre Kosten decken und den als Aufschlag darauf berechneten Gewinn einbringen. Aus deren wechselseitiger Inanspruchnahme als Lieferanten und als Abnehmer für ihre jeweilige Gewinnkalkulation ergibt sich dank der Freiheit von den Schranken der jeweils schon realisierten Zahlungsfähigkeit, die ihnen der Kredit eröffnet, ganz von selbst der Effekt, dass Preissteigerungen – aus welchen Gründen auch immer –, die den Kapitalvorschuss verteuern, sich realisieren und von den betroffenen Firmen mehr oder weniger erfolgreich weiterreichen lassen; aufs Ganze gesehen am Ende im Kreis herum, so dass tatsächlich nicht der kapitalistisch produzierte Reichtum, d.h. der für die Erneuerung und Ausweitung des Geschäftsgangs benötigte und kalkulierte Warenwert zugenommen hat, sondern bloß der Preis, der Ausdruck dieser Werte in gesetzlichen Zahlungsmitteln gestiegen ist. Vom Kreditgewerbe, das die benötigten Geldsummen bereitstellt, solange es sich Gewinne für sich selbst ausrechnet, wird der Effekt, dass in der Tendenz der Geldausdruck einer Kapitalverwertung stärker zunimmt als die erwirtschaftete wirkliche Zugriffsmacht des Kapitals, konstruktiv verarbeitet, nämlich mit der – möglichst schon vorauseilenden – Berechnung höherer Zinsen quittiert, die dann ihrerseits wieder die Kosten der kreditierten Geschäftstätigkeit steigen lassen. Die Tendenz zu Preiserhöhungen wird dadurch konsequent so verallgemeinert, dass der Wert des gesetzlichen Geldes, der eben nicht mehr durch die in Warenform produzierte und am Markt realisierte Zugriffsmacht des kapitalistisch verwerteten Eigentums festgelegt, sondern aus den Konkurrenzresultaten, den Preiszetteln und den auf deren Basis getätigten Umsätzen abgeleitet ist, entsprechend sinkt.
So sorgt die Freisetzung des Kreditgeschäfts per Unterordnung des gesetzlichen Geldes unter die Funktion des Kreditzeichens, vermittelt über die Konkurrenz der kreditfinanzierten Warenproduzenten und Kaufleute, für den Trend, dass die kapitalistische Vermehrung der Macht des Eigentums über Arbeit und Reichtum der Gesellschaft hinter der Mehrung des Kredits und des zirkulierenden Kreditgelds zurückbleibt; ein Defizit, das eben in der Form praktisch wirksam wird, dass die staatlich definierte und verbindlich gemachte Maßeinheit des abstrakten Reichtums schrumpft. Der Effekt ist im Übrigen nicht weiter schlimm, solange die Macht des kapitalistischen Eigentums per Saldo noch zunimmt.6) Problematisch wird es, wenn die staatlich approbierte Kreditschöpfung keine wachsende Kapitalmacht, sondern nur noch ein nominelles Wachstum hervorbringt und womöglich noch nicht einmal mehr die Reproduktion der Macht des Kapitals gelingt. Noch problematischer ist es allerdings, wenn die Preise allgemein schrumpfen und der Wert der Geldeinheit steigt. Dann hat nämlich das Bankgewerbe mangels Erfolgsperspektive insgesamt weniger Kredit geschöpft und vergeben als auch nur zur Reproduktion des vorhandenen Kapitals nötig; die Firmen sind dazu übergegangen, ihre Konkurrenten mit Preisnachlässen in den Ruin zu treiben, um selber zu überleben.
Zusatz
Inflation bezeichnet einen allgemeinen Preisanstieg und drückt diesen an dem Geld aus, mit dem die dauerhaft angestiegenen und weiter ansteigenden Preise bezahlt werden: als Geldentwertung. Im laxen Sprachgebrauch der Öffentlichkeit ist damit meistens nicht mehr gemeint als die rechnerische Umkehrung der Teuerungsrate, die statistisch anhand diverser Warenkörbe ermittelt wird; der Endverbraucher wird damit über den durchschnittlichen Anstieg seiner Lebenshaltungskosten aufgeklärt. Ökonomisch will die Inflationsrate aber als Urteil über das Geld verstanden sein. Diese Diagnose einer Wertminderung des Geldes abstrahiert von allen besonderen, branchen- und warenspezifischen Konkurrenzverhältnissen und Erpressungen zwischen Angebot und Nachfrage, von denen ein allgemeiner Preissteigerungseffekt allemal ausgeht; abgesehen wird ebenso von der unterschiedlichen Betroffenheit der verschiedenen marktwirtschaftlichen Geschäftszweige und gesellschaftlichen Klassen; die Konstruktion idealtypischer Warenkörbe dient – in Ermangelung einer Geldware als Messlatte – als Hilfsmittel, den Wert des Geldes im Zeitverlauf an sich selbst zu messen und dessen Verfall zu dokumentieren. Die Metapher ‚Aufblähung‘ gibt an, an welche Ursache dabei gedacht ist: Geld verliert an Wert, weil notorisch zu viel davon in Umlauf ist, so dass das allgemeine Preisniveau dadurch ‚aufgeblasen‘ wird.
Die naheliegende Frage danach, im Verhältnis wozu das zirkulierende Geldquantum zu groß ist, nach der Quelle dieses Übermaßes und nach dem Grund seines chronischen Charakters führt, sachlich genommen, zum Kreditgewerbe und der ökonomischen Natur seines Geschäftsmittels. Die Branche hat und nutzt die Macht, in einem Umfang, der ihre Wachstumsansprüche befriedigt und ihrer Risikokalkulation entspricht, Vorschuss für die Konkurrenz der Firmen um Wachstum zu liefern und Zahlungsfähigkeit in Erwartung und als Hebel der Kapitalakkumulation zu schöpfen; so vermag sie bloß scheinbares Wachstum ebenso zu finanzieren wie einen Geschäftsgang, der seine eigenen Voraussetzungen nicht reproduziert. An der Wirkung aufs nationale Geld wird zum andern die Macht des Staates deutlich, ein bloßes Geldzeichen zum wirklichen Geld der Gesellschaft zu erklären und das Kreditgewerbe mit seinen Berechnungen und seinen Erfolgen und Misserfolgen zum Regulativ des Wertquantums zu machen, das sein gesetzlich vorgeschriebenes Zahlungsmittel verkörpert.
Der marktwirtschaftliche Sachverstand, besorgt um das Gelingen der nationalen Ökonomie, erklärt sich seinen Befund, wonach ein allgemein steigendes Preisniveau Folge eines entsprechend hohen ‚Geldüberhangs‘ ist, lieber tautologisch mit der Idee eines rechten Maßes, gegen das verstoßen worden sei: einer Geldmenge, die der Warenmenge irgendwie, jedenfalls exakt entspricht; gerade groß genug, um damit nur gerechtfertigte Preisforderungen zu bezahlen, so dass damit nur solides Wachstum und keine unsolide Teuerung zu finanzieren ist. Die Wissenschaft steuert dazu ihre Erklärung des Geldes bei: seine Gleichsetzung mit der Funktion, den Warenabsatz zu vermitteln, und das daraus abgeleitete modelltheoretische Dogma, wonach das Geld im Grunde nur den Kreislauf der Güterwirtschaft gegenläufig abbildet, im Prinzip also von einer Übereinstimmung zwischen Warenmenge und für ihren Umsatz nötiger Geldmenge auszugehen sei; die wäre durch ein Übermaß an Geld – schuld