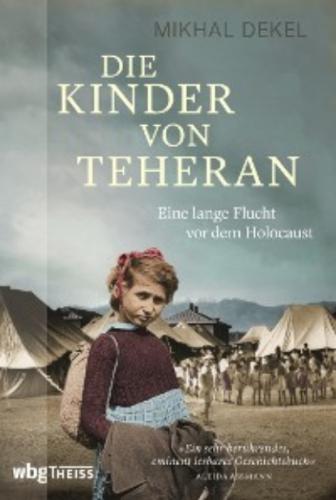„Das solltest du aufschreiben!“, sagte Salar. „Die Geschichte deines Vaters meine ich.“ Ich winkte lachend ab: „Nein, nein – aber du könntest das schreiben. Du bist doch im Iran geboren. Und du bist nicht in den Holocaust verwickelt. Deine Vorfahren waren weder Täter noch Opfer damals. Und du kennst dich besser mit Flüchtlingen aus als ich.“ Salar und seine Brüder waren nach der Islamischen Revolution von 1979 als Teenager in die Vereinigten Staaten geflohen, wie er mir erzählt hatte. Bald fielen mir gewisse Ähnlichkeiten zwischen ihm und meinem Vater auf, kleine, beinahe mikroskopische Wesenszüge und Angewohnheiten, die man wohl nur bemerken konnte, wenn man sich von Kindheit an in das Zusammenleben mit einem Geflohenen eingeübt hatte: die Art etwa, wie Salar ein Papierhandtuch säuberlich in zwei Hälften teilte, um die zweite Hälfte für später aufzuheben; wie er stets seinen Teller leer aß; sein überhaupt leicht ängstlich-besorgtes Verhältnis zu Nahrung; seine Befürchtung, sich zu verkühlen; seine Vorsicht und Zurückgezogenheit.
„Mein Vater hat keine Geschichte“, gab ich Salar zur Antwort. „Ich werde mich an seinem Porträt versuchen“, hatte ich immer gesagt, wenn Leute mich nach ihm fragten, „aber es wird mir niemals gelingen.“ Vater war ein ruhiger, unauffälliger Mann aus einem beschaulichen Städtchen im Norden Israels gewesen, und inzwischen, vierzehn Jahre nach seinem Tod, war das Bild, das ich von ihm hatte, verschwommen und ziemlich sachlich geworden: ein durchaus umgänglicher, aber zurückhaltender Mann, nicht ganz ohne Strenge, der zu gelegentlichen Wutausbrüchen neigte. Von seiner Familiengeschichte wusste ich nichts; und ich glaubte auch nicht, dass ich auf diesem Weg viel über ihn erfahren würde. Wörter wie „Trauma“ und „Verdrängung“, „Vertreibung“ oder „Zwangsmigration“ kamen mir nicht in den Sinn, wenn ich an ihn dachte – ja, seltsamerweise noch nicht einmal das Wort „Flüchtling“. In meiner Vorstellung war er wohl zuallererst ein Arbeiter – ein fleißiger Mann, der in einer Art von zermürbender Dauergegenwart lebte, wo er tagein, tagaus seine Pflicht erfüllte. Gefühle zeigte er nur selten und hat in meiner Gegenwart nur ein einziges Mal geweint: als nämlich Christopher Walken als amerikanischer Kriegsgefangener in dem Film Die durch die Hölle gehen von seinen Vietcong-Wächtern zu einer Partie russisches Roulette gezwungen und brutal misshandelt wird. Wir schauten uns diesen Film zu Hause im Fernsehen an, mein Vater, mein Bruder und ich, und ich kann mich noch genau erinnern, wie ich zu Vater hinübersah – es war Winter, wenn ich mich recht entsinne, und in unserer Wohnung in Haifa war es wie immer ein bisschen zu kalt – und bemerkte, dass seine blauen Augen gerötet waren und Tränen seine Wangen hinunterliefen.
Zu Hause waren wir zu sechst: meine Eltern, meine Geschwister und ich, dazu meine Großmutter väterlicherseits, Rachel (Ruchela), die wir „Achel“ nannten: eine zierliche, magere Frau mit bleicher, runzliger Haut und blauen, leicht schräg gestellten Augen, ganz wie mein Vater sie hatte. Hannan war während des Krieges von seiner Mutter getrennt worden, und als sie dann Jahre später in Israel ankam, zog sie bei ihm ein, wohnte dann bei meiner Mutter und ihm, schließlich bei uns allen. Solange ich zurückdenken kann und bis zu ihrem Tod im Jahr 1981 hatte sie ihr kleines Zimmerchen gleich neben der Küche in unserer ruhigen Etagenwohnung auf dem Berg Karmel hoch über Haifa. Wir redeten nicht viel mit ihr, und sie redete nur wenig mit uns – sie redete überhaupt wenig, sondern verbrachte einen großen Teil des Tages in ihrem Zimmer, wo sie las oder Radio hörte. Meine Mutter, die für sie kochte und putzte und ihre Wäsche machte, konnte ihre Schwiegermutter nicht ausstehen. Mein Vater, der meiner Mutter gegenüber oft, uns Kindern gegenüber manchmal, die Beherrschung verlor, ohne dass ein Grund dafür erkennbar gewesen wäre, behandelte Achel stets mit einer liebevollen Fürsorglichkeit. Manchmal blieb die Großmutter den ganzen Tag in ihrer Kammer und kam erst heraus, wenn ihr Sohn von der Arbeit zurückkehrte. Ich kann mich nicht erinnern, dass mein Vater und seine Mutter jemals gestritten hätten, es gab keinerlei Spannungen zwischen ihnen, nur eine tief empfundene Harmonie. Immer war es, als träten zwei Mannschaften gegeneinander an: er und sie gegen meine Mutter und uns Kinder.
Als ich sechs oder sieben Jahre alt war – ich hatte gerade schreiben gelernt –, schrieb ich meinem Vater einen Brief, in dem ich ihn fragte, weshalb er seine Mutter lieber hätte als uns. Ich steckte die Botschaft unter sein Kissen im Ehebett meiner Eltern und wartete mit banger Sorge ab, was er dazu sagen würde. Als Hannan den Brief fand, geriet er außer sich vor Wut und schimpfte mich aus, dass er es niemals gewagt hätte, seinem Vater einen derartigen Brief zu schreiben. Ich kann mich noch gut an mein Schuldgefühl erinnern, an die Scham, an den verzweifelten Wunsch, meine Worte zurücknehmen zu können – lauter Gefühle, die mich über Jahre gequält haben. Mein Vater hat danach lange Zeit kein Wort mit mir geredet, und obwohl wir noch ein erfülltes gemeinsames Leben vor uns hatten – viele Momente zusammen, auch viele glückliche –, sollten wir doch nie wieder ganz unbefangen miteinander umgehen.
In New York, wohin ich 1992 gezogen war, wurde das Leben leichter. Ich heiratete einen Mann, der heiterer war, schuf mir ein Zuhause, das heiterer war, und begann Literaturwissenschaft zu studieren. Mein Vater schickte mir Briefe – rührende, gut geschriebene, überraschend warmherzige –, in denen von einem möglichen Besuch in New York die Rede war und von anderen Plänen, die er für die Zeit seines Ruhestands schmiedete. Aber noch im selben Jahr – er war gerade von einer Reise nach Polen zurückgekehrt, wo er zum ersten Mal seit 53 Jahren seine Vaterstadt besucht hatte – wurde er krank. Im Jahr darauf starb er, im Alter von 66 Jahren, an der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, einer seltenen degenerativen Hirnerkrankung.
Ich flog nach Israel, um ihn vor seinem Tod noch ein letztes Mal zu sehen. Zum damaligen Zeitpunkt konnte er noch Auto fahren (wenn auch sehr viel waghalsiger als gewöhnlich), und so rasten wir die steilen Serpentinen des Derech ha’jam („Meerweg“) von Haifa hinunter bis zum Strand von Karmel, wo wir schon Jahre zuvor gemeinsam gewesen waren. Anders jedoch als bei den Strandausflügen meiner Kindheit – ein großes, spannungsreiches, potenziell explosives Unterfangen, bei dem Handtücher, Strandmuscheln, Kühlboxen, Sandwiches und fünf menschliche Körper in einen winzigen Renault 4 aus Militärbesitz (und ohne Klimaanlage) gezwängt wurden –, anders als bei jenen vergangenen Ausflügen waren wir jetzt nur zu zweit und hatten jeder nur ein kleines Handtuch dabei, was so etwas wie Nähe, ja sogar eine gewisse Lockerheit ermöglichte, wenn auch der Hauch von Entfremdung nie ganz zu vertreiben war, der sich über uns gelegt hatte, als ich sechs oder sieben Jahre alt gewesen war. Als wir am Saum des Meeres angekommen waren, legte mein Vater seine Oberbekleidung ab (die Badehose trug er schon darunter), legte alles ordentlich zusammen und platzierte den Kleiderstapel zusammen mit seinen blank gewienerten braunen Ledersandalen fein säuberlich auf seinem kleinen Handtuch. Eine ganze Weile ließ er sich im Mittelmeer treiben, die Augen geschlossen, vollkommen friedlich sah das aus. „Eize jam“, sagte er, „was für ein Meer“ – wie er es immer sagte, wenn das Wasser als eine absolut glatte, tiefblaue Ebene vor uns lag. Mein Vater war noch nie ein Mann vieler Worte gewesen, und jetzt hatte er sogar nur noch weniger. Auf der Heimfahrt sagte er mir, ohne dass ich ihn