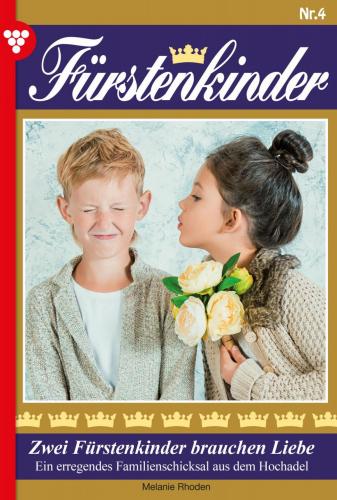»Wo sind die Kinder jetzt?« wiederholte der Fürst seine Frage, die noch immer nicht beantwortet worden war.
Der Chirurg strich mit einer müden Handbewegung über seine Stirn. Er hatte einen schweren Tag hinter sich. »Es wäre wichtig, die Kinder möglichst schnell aus der Atmosphäre der Klinik zu bringen. Deshalb bitte ich Sie, eine Vertrauensperson und Vertraute der Kinder unverzüglich von Ihrem Schloß kommen und die Kleinen abholen zu lassen. Am besten wäre eine Heimfahrt in der Nacht. Wenn die Kinder am nächsten Morgen aufwachen, werden sie die Wahrheit nur noch wie einen bösen Traum einschätzen.«
Fürst Rainer von Wildberg-Kallau nannte den Namen des Kindermädchens, und eine Krankenschwester notierte sofort die Telefonnummer.
Fürst Rainer bat mit leiser, gepreßt klingender Stimme: »Ich würde aber die Kinder vorher noch gern sprechen und…« Er verstummte, weil der Professor durch ein Kopfnicken ohnehin sogleich seine Zustimmung gegeben hatte. Der Fürst quälte sich, um seine Gedanken einigermaßen klar zu sammeln. »Die Fürstin von Vingenstein? Professor, sie lebt?«
Die Züge im hageren Gesicht des Chirurgen zeichneten sich noch schärfer ab. Selbst nach so vielen Jahren der ärztlichen Pflichterfüllung deprimierte es ihn noch immer nachhaltig, wenn er erkennen mußte, wie ohnmächtig der Mensch nur zu oft dem übermächtigen Gegner, dem Tod, gegenüberstand. Er sagte seltsam hastig: »Habe ich selbst heute nachmittag operiert. Nun müssen wir abwarten.«
»Die Wahrheit!« verlangte der Fürst herrisch, mit harter Stimme. »Herr Professor, ich halte Inventur. Sagen Sie mir doch ehrlich, wieviel mir noch geblieben ist! Fürstin Thea, die Mutter meiner Frau, liebe ich nicht weniger, als wäre sie meine eigene Mutter. Wie groß sind ihre Chancen?«
Leise gestand Professor Wernhoff: »Keine Chancen, wieder gesund zu werden, Durchlaucht. Die Fürstin lebt und wird vielleicht noch drei, vier Monate… Die Fürstin bleibt querschnittgelähmt…«
Rainer von Wildberg-Kallau starrte regungslos zur weißen Zimmerdecke. Seltsamerweise dachte er in diesem Augenblick: In China ist Weiß die Farbe der Trauer, die Farbe des Todes… Und dann: Warum habe ich die Sicherheitsgurte angelegt? Wie sinnlos, daß ich am Leben geblieben bin!
Aber schon im nächsten Augenblick wurde ihm sein verzweifelter Gedanke widerlegt, denn von der Tür her hörte er das kleine, verängstigte Stimmchen Renis: »Papa…«
»Reni!« So schnell es sein schmerzender Brustkorb erlaubte, drehte sich der Fürst um. Neben dem vierjährigen Töchterchen stand der sechsjährige Sohn. Ein echter von Wildberg. Er wußte noch nichts vom Tod seiner Mutter. Deshalb zwang sich der Fürst zu einem ermunternden, heiteren Ton und rief: »Wie seht denn ihr aus! Reni, das Pflaster an der Stirn macht dich ganz besonders hübsch. Und Ronni hält sich bewunderungswürdig…«
»Papa!« Jetzt weinte der Junge verzweifelt auf. Die beiden rannten auf ihren Vater los und warfen sich verzweifelt über ihn. Nur mit Mühe unterdrückte der Fürst einen Schmerzensschrei. Er lächelte den Kleinen ermutigend zu.
»Hört, Kinder«, sagte er nach einigen Minuten, die er gebraucht hatte, um seine chaotisch durcheinanderhetzenden Gedanken einigermaßen unter Kontrolle zu bringen. »Cilly wird euch noch heute nacht von hier wegholen und nach Hause bringen. Ihr werdet artig folgen und ihr keinen Ärger machen!«
»Ja, Papa«, versprach Ronni, der Ältere, tonlos.
»Keine dummen Streiche!« verlangte der Fürst, wobei er sich zu einem Lächeln zwang.
Und wieder Ronni mit starrem Gesicht: »Ja, Papa.«
Fürst Reiner streichelte mit einer unbeholfenen, zärtlichen Geste über die vom durchlebten Entsetzen schmal gewordenen Wangen seiner Kinder. Sie sollen doch endlich gehen! schrie es in seiner verletzten Seele. Sie sollen gehen und mich nicht so stumm vorwurfsvoll anschauen! Mich trifft doch keine Schuld!
Da stellte Ronni die schreckliche Frage: »Papa, wann wird Mama nachkommen?«
Und die kleine Reni stimmte ein: »Ja, Papa, wird Mama nicht gleich mit uns kommen?«
Der Kopf der diskret im Hintergrund wachenden Krankenschwester fuhr herum, denn sie ahnte, daß nun wieder eine Krisis ausbrechen werde.
»Mama?« würgte der Fürst hervor. Er atmete so schwer, daß es wie Röcheln klang. Es kostete ihn übermenschliche Kräfte. Zu einer Lüge konnte er sich nicht mehr aufraffen, und so sprach er doch die Wahrheit, als er keuchend sagte: »Fahrt nur, Kinder. Mama wird… in ein paar Tagen nachkommen. Für immer.«
Rasch brachte die Krankenschwester die beiden Kinder aus dem Raum, und kaum hatte sich die Tür hinter ihr geschlossen, brach Fürst Rainer von Wildberg-Kallau in ein verzweifeltes Schluchzen aus.
*
Die Ärzte entließen den Fürsten nach zwei Tagen aus der Klinik. Es geschah auf den Wunsch des Fürsten und gegen die Überzeugung der Ärzte. Weil das aber der Tag vor dem Begräbnis von Fürstin Vera war, stimmten sie nach einigem Zögern zu.
Das Kindermädchen Cilly hatte, als es Ronni und Reni abholte, einen neuen Anzug mitgebracht. Als der Fürst sich ankleidete, kam er kaum allein zurecht, weil seine Hände unkontrollierbar zitterten. Endlich hatte er es doch geschafft. Er lehnte die Hilfe einer Krankenschwester mit dem Hinweis ab: »Ich werde mich künftig ganz allein zurechtfinden müssen. Danke, ich brauche keine Hilfe mehr.«
Er bemühte sich, ein völlig ausdrucksloses Gesicht zu wahren, denn niemand sollte ahnen, welch furchtbare Begegnung ihm nun noch bevorstünde. Als er zur Tür ging, zog er die Beine schleppend weiter, als litte er an Lähmungen. Jeder Schritt forderte ihm nicht nur körperliche Kräfte, sondern noch viel mehr seelische Überwindung ab.
»Zimmer neunzehn?« fragte er knapp die Krankenschwester. Seine Stimme klang so unpersönlich und abweisend, daß er erst gar nicht betonen mußte, er wollte allein gehen. Also beschrieb ihm die Schwester den Weg.
»Danke.« Hoch aufgerichtet, beinahe arrogant schleppte sich der Fürst über den Korridor. Nun kam ihm doch die Krankenschwester nach und beobachtete, ob er den Weg allein schaffte. Sie erschrak, als der Fürst sich plötzlich umdrehte und verlangte: »Schwester, besorgen Sie mir sofort Blumen! Ich brauche sie! Sofort… ich habe nicht mehr viel Zeit.«
Schwester Maria lief fort, nahm einfach aus der großen Vase in der Empfangshalle der Privatklinik einen Blumenstrauß und brachte ihn dem Fürsten. Gleich darauf klopfte Rainer von Wildberg-Kallau an Tür Nummer neunzehn. Sein Herz schlug zum Zerreißen heftig, als ihn die noch immer recht schwache Stimme seiner Schwiegermutter zum Eintreten aufforderte.
»Rainer!« rief sie, als sie ihn, noch in der Tür stehend, erkannte. »Wie schön, daß du mich besuchst! Jetzt glaube ich erst, daß alles wieder gut wird, denn du siehst wirklich blendend aus. Setz dich zu mir, Rainer! Eine kleine Stunde eines so lieben Besuchs müssen mir auch diese verständnislosen Ärzte gewähren. Stell dir vor, Rainer, sie wollen mich noch ein paar Wochen hierbehalten, was ich völlig unsinnig finde. Man sollte mich nur aufstehen lassen, und ich würde diesen Unmenschen beweisen, daß ich zumindest mit Krücken humpeln könnte!«
Rainer von Wildberg war seiner Schwiegermutter von Herzen dafür dankbar, daß sie ohne Unterlaß redete und redete. Selbstverständlich begriff er, daß sie damit ihre panische Angst übertönen wollte. So rasch er nur konnte, ging er auf sie zu, neigte sich zu ihr herunter und streifte ihre Wangen mit den Lippen. Mit Mühe verbarg er sein Erschrecken darüber, wie tief diese Wangen in den letzten Tagen eingefallen waren. Die Augen lagen in dunklen Höhlen, wirkten stumpf und trüb.
»Ein paar Blumen«, sagte er und schaute auf die Blüten, um dem angstvoll forschenden Blick der Fürstin auszuweichen. »Wir wollen einer Schwester läuten, denn ohne Wasser…«
Er wußte nicht mehr weiter und spürte, daß er am Rande seiner Kräfte war.
»Ohne