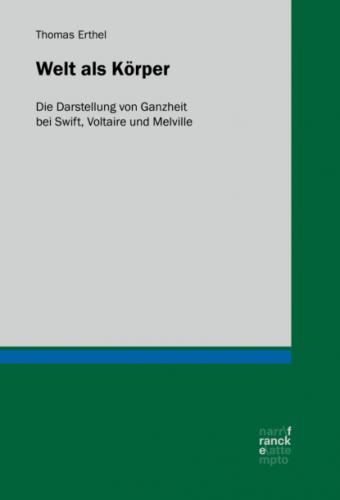Betrachtet man in diesem Kontext Hans Blumenbergs Ausführungen zu ‚Welt‘ in der Theorie der Unbegrifflichkeit,1 so stößt man auf die Anekdote, dass er nach einem Vortrag die Frage, wie er ‚Welt‘ definiere, nicht habe beantworten wollen: „In meiner Verzweiflung entschloß ich mich zu einer Parodie: ‚Die Welt ist der geometrische Ort aller Punkte‘“ (38). Als Grund für diese Weigerung gibt er explizit den Wunsch an, eine Diskussion von Wittgensteins Welt-Verständnis zu umgehen.2 Dieser Wunsch impliziert die Annahme, dass eine philosophische Diskussion nicht den Königsweg zu einem besseren Verständnis von ‚Welt‘ darstellt. Stattdessen hält er diese ernüchternde Erkenntnis fest: „‚Welt‘ ist ein Ausdruck, bei dem der Versuch, Wortersetzungsregeln zu finden, konstitutiv zum Scheitern verurteilt ist.“ (ebd.) Man kann sich ‚Welt‘ anscheinend nicht ohne weiteres annähern: Regeln zur Synonymbildung – fester Bestandteil jeder Definition – können laut Blumenberg nicht gelingen. Dennoch, so weiter die Pointe Blumenbergs, entkommt man dem Wort ‚Welt‘ nicht. Zur Illustration führt Blumenberg nahezu völlig sinnentleerte Verwendungen von ‚Welt‘ ins Feld, wie etwa in hohlen Aussagen „wie ‚Die Welt ist schlecht‘ oder ‚Die Welt steht vor dem Untergang‘“ (ebd.).3 Anhand dieser Beispiele macht er deutlich, dass ‚Welt‘ in ihrem Gehalt nahezu unmöglich einzugrenzen ist, und dennoch – oder sagt man treffender: deswegen? – sehr häufig gebraucht wird. Hayot beschreibt die von Blumenberg damit adressierte Problematik mit der Aussage, dass „non-tautological, precise statements about the world are harder to make than one might think.“ (39) Obwohl man gewissermaßen ständig nicht umhin kommt, ‚Welt‘ zu sagen, ist es unmöglich, den genauen Gehalt dieses Wortes zu definieren. Entsprechend will Blumenberg – im Scherz – ein Wort-Verbot nicht gänzlich ablehnen: „Selbst wenn ich zur Zustimmung geneigt wäre, man solle Sätze über ‚die Welt‘ fortan lieber überhaupt nicht mehr bilden oder gebrauchen, wäre ich doch sehr unsicher, ob diesem Verbot jemals Erfolg beschieden sein könnte.“ (38) Dabei ist jedoch explizit auf Blumenbergs Verständnis von ‚BegriffBegriff (im Verhältnis zu Figur)‘ einzugehen, als welchen er ‚Welt‘ verstanden wissen will. Blumenbergs ‚Begriff‘ ist – vielleicht kontraintuitiv, aber einleuchtend – durch seine Undefinierbarkeit bestimmt, denn er führt aus: „Der Begriff hat etwas zu tun mit der Abwesenheit seines Gegenstandes. Das kann auch heißen: mit dem Fehlen der abgeschlossenen Vorstellung des Gegenstandes.“ (9) Weiter schreibt er: „Es könnte sein, daß die Leistung des Begriffs nur partiell gegenüber der Intention der Vernunft ist, die immer etwas mit Totalität zu tun zu haben scheint.“ (9) Im Blumenberg’schen ‚Begriff‘ ist damit eine Spannung eingeschrieben, die unauflösbar ist: die Vernunft will zur Totalität; ein Wunsch, den der so verstandene Begriff „nur partiell“ bedient, denn in ihm ist immer auch die „Abwesenheit seines Gegenstandes“ eingeschrieben. Damit ist der ‚Begriff‘ „zur Enttäuschung der auf ihn gesetzten philosophischen Erwartung nicht die Erfüllung der Intentionen der Vernunft, sondern nur deren Durchgang, deren Richtungsnahme.“ (10) In diesem Verständnis von ‚Welt‘ ist diese stets entzogen, insofern sie als ‚Begriff‘ nur eine Richtung ‚auf sie hin‘ vorgibt.
Als weitere Argumente für die Unmöglichkeit, Welt zu definieren, lassen sich ‚konzeptuelle Ambivalenzen‘ anführen, welche die FdG ‚Welt‘ birgt. Eric Hayot weist, ausgehend vom Eintrag zu world im OED, auf folgenden Zusammenhang hin:
Its [der Welt; T.E.] definitions in the Oxford English Dictionary run to some forty pages, and its complexity and slipperiness appear from the very first one: “human existence; a period of this,” words whose reference mostly to time will surprise anyone accustomed to thinking of “world” as having largely spatial implications. The second major definition makes things both better and worse: “the earth or a region of it; the universe or a part of it.” Here we are on familiar spatial ground. But what to make of that double “or”? Like the semicolon in the first definition, it forces “world” to pivot between an ontological reference to any self-enclosing whole (what are, after all, periods, regions, or parts of wholes but wholes themselves?) and a material reference to the largest possible versions of such wholes (history; the planet Earth; the universe). By highlighting the tension between world as a generic totality and world as the most total totality of all–the totality of the “part” and the totality of the “whole” – this ambivalence recapitulates the difficulties generated by the “world” of world-systems and the “world” of world literature. […] “[W]orld” thus bears within itself the conceptual difficulty that makes its use in contemporary literary criticism so fecund, and so incoherent. (38f.)
Was Hayot hier als „conceptual difficulty“ beschreibt, umfasst folgende Struktur: ‚Welt‘ kann sowohl die „totality of the ‘part’“ (eine Region, eine Zeitspanne etc.) als auch „the totality of the ‘whole’“ bezeichnen, wobei Letzteres von ihm auch beschrieben wird als „the most total totality of all“. Letztgenannte Formulierung buchstabiert das Potenzial von ‚Welt‘, schlicht alles zu bezeichnen, mit spielerisch-ironischem Gestus aus. Robert Stockhammer äußert zu diesem Sachverhalt (wiederum unter Bezug auf ein Wörterbuch, diesmal das von Jacob und Wilhelm Grimm begründete Deutsche Wörterbuch) das Folgende:
Kleine Welten, wie diejenigen einer Mäusegemeinde oder eines Maulwurfsbaus, wären dann nur anders skaliert als der ‚kreis der erdbewohner‘ […] oder – davon bemerkenswerterweise „nicht scharf abzugrenzen“ – der ‚erdkreis‘ […]. Und ‚Welt‘ im Sinne von ‚Weltall‘ […] wäre, als größtmögliche Skalierung, zugleich eine Hyperbel, die auf das größte denkbare All zielt. Auch dieses ist noch „ein all im kleinen“, insofern es als ein irgendwie „abgeschlossenes ganzes“ gedacht wird […]. (Stockhammer, „Welt“ 50)
Die Größe dessen, was ‚Welt‘ bezeichnet, kann demnach stark variieren, es handelt sich um eine flexible Extension. Auch Roland Robertson scheint sich dieser Flexibilität bewusst zu sein, insofern er in seiner Verwendung von ‚world‘ gehäuft ein „as a whole“ anhängt (8, 10, 13, 14, 15, 24, 25, 26, 28, 31 etc.) – um deutlich zu machen, dass es ihm in diesem Sinne um ‚world‘ geht, und nicht nur um einen Ausschnitt der Erde. ‚Welt‘ ist, kurz gesagt, ‚skalierbar‘.Maßstab (Kartografie)4
C. S. Lewis5 widmet ein ganzes Kapitel seines 1960 erschienenen Studies in Words dem Wort ‚world‘. Dabei weist er darauf hin, dass sich world in zwei Hauptbedeutungen unterteilen lässt: „In the earliest recorded period of our language this noun has two senses which we may call World A and World B.“ (214) Er führt aus: „[T]o cover all the shades of the A-sense we had better say that World A means something like age or durée.“ (214)6 Die zweite Bedeutung dagegen entspricht der, die ein heutiger Sprecher auch im Sinn haben wird:
The B-sense is that which the word most naturally suggests to a modern speaker. The poet who did the Metres of Boethius into Anglo-Saxon writes ‘in those days there were no great houses in the weorulde’. Here we could translate it ‘earth’. But whenever the distinction between the earth and the universe is present in the mind, World B can mean either, and the context usually shows which. (215)
Hier ist vor allem die weitere Differenzierung von ‚Welt‘ in die Bedeutungen ‚universe‘ und ‚earth‘ entscheidend. Weiter definiert Lewis: „World B may loosely be defined as the region that contains all regions; if all absolutely, then it means universe; if ‘all that usually concern us humans’, then it means earth.“ (215) Dem ist hinzuzufügen, dass ‚world‘ mit dem Lauf der Zeit zunehmend weniger die Bedeutung von ‚universe‘ zu tragen scheint: „On the other hand, world is decreasingly used to mean the absolute region of regions; universe tends to replace it. Partly, no doubt, this has happened because the ambiguity of world can cause inconvenience.“ (249)7 Der sukzessiven Ersetzung von ‚world‘ durch ‚universe‘ hat Alexandre Koyré ein ganzes Buch gewidmet, dessen Titel sein Ergebnis konzis zusammenfasst: From the Closed World to the Infinite Universe.8
„[T]he equation of the world with the spatial extensiveness of the globe“ (Chea 48) also