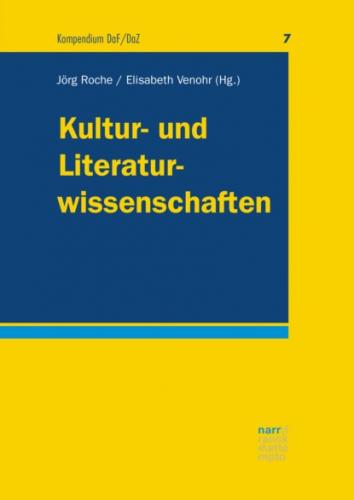Die Frage ist, wie sich mentale Modelle erforschen und darstellen lassen und wie sich die Änderungen messen lassen.
Schematheorien bieten für die Darstellung der dynamischen Wissenskonstruktion und ‑umstrukturierung, die auch zur Ausbildung sich verfestigender Schemata in mentalen Modellen führen kann, einen operationablen Rahmen an. Es zeigt sich dabei zum einen, dass sich mentale Modelle durch Wiederholungen etablieren und stabilisieren können, dass aber externe, deklarative Information zur Veränderung der Schemata und Modelle von Nutzen sein kann. Eine Effizienzsteigerung bei der Veränderung mentaler Modelle lässt sich vor allem dann erreichen, wenn die neue Information an die vorhandenen subjektiven mentalen Modelle andockt.
Wie die Messung der Modellveränderungen (Wissenserwerb) erfolgen kann, versucht Ifenthaler (2006) im Rahmen des HIMATT-Projektes (Highly Integrated Model Assessment Technology and Tools) mit Konzeptkarten computertechnisch zu operationalisieren. Der Ablauf der Schemaaktivierung in Folge einer Aufgabenstellung kann hierzu vereinfachend folgendermaßen dargestellt werden:
Abbildung 2.2: Prozessmodell zur Veränderung mentaler Modelle und der Restrukturierung kognitiver Schemata nach Ifenthaler (2006)
Bei Passgenauigkeit führt die Aktivierung der Schemata unmittelbar zur Lösung (AssimilationAssimilation). Ist die Schemaaktivierung nicht ausreichend zur Bearbeitung der Aufgabe, erfolgen Reorganisations- und Revisionsprozesse der Schemata und mentalen Modelle (AkkomodationAkkomodation). Durch diese Prozesse kann ein Schema erweitert (accretionaccretion) oder angepasst (tuningtuning) werden. Genügen diese Prozesse nicht für die Lösung der Aufgabe oder sind die mentalen Modelle nicht adäquat, setzen Reorganisationsprozesse der mentalen Modelle ein. Diese können zu einer Revision der Modelle und damit zu einer Lösung führen, aber auch erfolglos bleiben. Die Erfolgsaussichten für die Lösung einer Aufgabe lassen sich erhöhen, wenn alternative Schemata und Modelle bereits zur Verfügung stehen. Auch diese können zu einer unmittelbaren Lösung der Aufgabe führen oder in die Reorganisationsprozesse einfließen.
Schemata sind zwar empirisch nicht immer leicht zu fassen (Ifenthaler 2010), ihre Entstehungsprozesse, ihre Funktionen und ihre Veränderbarkeit lassen sich modellhaft dennoch gut darstellen. Am Beispiel der Schemaveränderungen bei Wechselpräpositionen durch eine animierte Grammatik (siehe Band »Sprachenlernen und Kognition«, Kapitel 2) konnte gezeigt werden, wie sich mittels der heute bereits verfügbaren Instrumente weitreichende Konsequenzen mentaler Modellierungen messen lassen. Mit diesen Instrumenten lassen sich auch die orientierenden und kategorisierenden Funktionen von Vorurteilen und Stereotypen wie auch deren Veränderbarkeit abbilden.
In vorherigen Lerneinheiten wurde bereits illustriert, wie die kognitiven Kategorisierungen der Lerner durch kulturspezifische mentale Modellierungen beeinflusst werden. Dabei ist davon auszugehen, dass die kognitiven Kategorien weniger universell ausgeprägt sind, als verbreitet angenommen wird. Sie sind variabel, abhängig von kulturspezifischen semantischen Eigenschaften und spielen eine entscheidende Rolle in der Entwicklung allgemeiner kognitiver Fähigkeiten.
Rather than cognitive categories being universal and giving rise to universal semantic categories, as is typically supposed, it seems that cognitive categories are variable and they align with crosslinguistically variable semantic categories. This work therefore contributes to the emerging view that language can play a central role in the restructuring of human cognition. (Majid, Bowerman, Kita, Haun & Levinson 2004: 113)
Gumperz und Levinson (1996) postulieren, dass diese kulturspezifischen Denkmodi im (ontogenetischen) Spracherwerb für das Sprechen erworben werden. Die Denkmodi reflektieren die linguakulturellen Differenzen und beeinflussen die kognitive Kategorisierung.
In this theory, two languages may ‘code’ the same state of affairs utilizing semantic concepts or distinctions peculiar to each language; as a result the two linguistic descriptions reflect different construals of the same bit of reality. These semantic distinctions are held to reflect cultural distinctions and at the same time to influence cognitive categorization. (Gumperz & Levinson 1996: 7)
Die Aufgabe, die Schemata verschiedener Provenienz in den gleichen kognitiven Strukturen zu vereinbaren und mittels kognitiver Prozesse zwischen ihnen vermitteln zu müssen, also Kategorisierungen unterschiedlicher Art nebeneinander zu verwalten, die gleichzeitig veränderbar sind und sich gegenseitig beeinflussen können, kann der Lerner beziehungsweise die Sprecherin oder der Sprecher lösen, wenn der Wissenszuwachs nicht zu einer Auflösung bestehender Modelle führt. Der Ansatz der Entwicklung konzeptueller Modelle geht zwar von einer Akkomodation bestehender Schemata und Modelle aus, steht aber nicht im Widerspruch zur Koexistenz und Interdependenz verschieden geprägter mentaler Modelle. Vergleiche auch Slobin (1996) und die kognitive Anthropologie von Goodenough (1970) und Goodenough (1964).
Wie gezeigt wurde, löst der Transdifferenzansatz das Problem der kognitiven Dissonanz nicht durch ein binäres System oder eine dritte oder höhere Qualität, sondern durch ein dynamisches Nebeneinander mehr oder weniger interagierender und temporärer Positionen und Einstellungen. In den Modellen von der Drittkultur (Bhabha 1994) oder dem Dritten Ort (Bennett 1993; Kramsch 1996) kommt diese Dynamik weniger zum Tragen und ist dort auch nicht unter kognitiven Aspekten behandelt worden. Nach dem Transdifferenzansatz stören die Differenzen die binäre Ordnung, aber substituieren sie nicht, sondern komplementieren sie (Lösch 2005: 28). Durch die dynamische Integration des Fremden in bestehende und sich verändernde Wissensbestände wird die binäre Trennung in Eigenes und Fremdes obsolet. Zwar sind unterschiedliche Wissensbestände identifizierbar, aber weder bleibt die Trennung bestehen noch muss es zu einer diffusen Hybridisierung kommen.
Die daraus entstehende transkulturelle Qualität der Wissensorganisation, die sich in Transdifferenz manifestiert, entwickelt sich nicht global, sondern selektiv nach Bedarf und Disposition in Domänen (ProvinzenProvinzen). Bemerkenswert daran ist, dass sich die Entwicklung transkultureller Kompetenzen als Komponente des Wissenserwerbs im Bereich dieser besonderen Interessen oder Interessensinseln bei günstigen Bedingungen sukzessiv sowohl auf andere Provinzen übertragen als auch auf globale Kompetenzen ausdehnen lässt. Das Funktionieren dieses sukzessiven Transferprozesses illustriert van Es (2004) am Beispiel der Entwicklung transkultureller Erscheinungen in Provinzen – wie der Musik – und ihrer anschließenden Übertragung auf andere Provinzen – wie den Sport oder die Mode –, bevor sie zu einer globalen Erscheinung werden. Provinzen können zu Themen wie Arbeitsplatz und Beruf, Sport, Musik, Folklore oder wissenschaftlichen Themen oder jedem anderen beliebigen Themengebiet gebildet werden.
Die Übertragung von transkulturellen Kompetenzen, die in einer Provinz erworben und praktiziert werden, auf andere Bereiche geschieht nicht automatisch. Auch sie bedarf der Vermittlung, Reflexion und Einübung. Nicht in der Einebnung oder Vermeidung dieser komplex erscheinenden Prozesse liegt die Aufgabe des Fremdsprachenunterrichts. Vielmehr ist er mit einer größeren Herausforderung konfrontiert, nämlich mit der Aufgabe, auch diese natürlichen Prozesse mit der richtigen Relevanz und Größe der ProvinzenProvinzen (Themen, Interessensgebiete) und dem richtigen Anspruchsniveau (Aufgabenstellungen) operationabel zu machen.
Die im Transdifferenzansatz angelegte multiple und dynamische Perspektivierung und die daraus resultierende Veränderung kognitiver Modelle lässt sich gerade in der Arbeit mit literarischen Texten und anderen Textgattungen nutzbar machen, und zwar dann, wenn die Lesart von Texten, das heißt die Perspektive auf eine Geschichte wie bei dynamischen Hypertexten erfolgt.
2.2.3 Konstruktion und Relationalität des Fremden
Die für die Einnahme einer anderen Perspektive nötige Veränderung der Einstellung gegenüber dem Fremden verlangt Bochner (1982) zufolge eine Umstrukturierung der kognitiven Kategorien der Individuen, wodurch sie tatsächlich „andere Menschen“ würden. Essentiell ist dabei laut Brière, dass interkulturelles