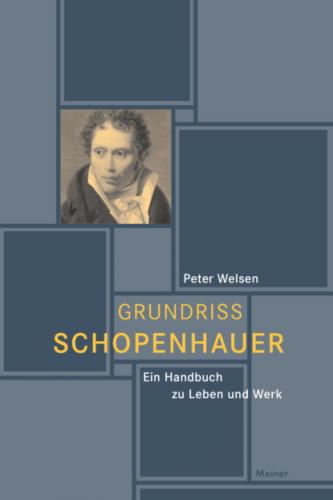Wie bereits angedeutet wurde, legt Schopenhauer neben der transzendentalen Betrachtung der Erkenntnis auch eine anthropologische – physiologisch und psychologisch ausgerichtete – vor, welche die Abhängigkeit des Intellekts von den Sinnesorganen, dem Nervensystem sowie dem Gehirn in den Vordergrund stellt. So sei der Intellekt als Funktion des Gehirns zu betrachten: »Dieser Intellekt ist das Sekundäre, ist das posterius des Organismus und, als eine bloße Gehirnfunktion, durch diesen bedingt.« (N 219 f.) Damit erweise sich der Intellekt – und damit auch die Erkenntnis – letztlich als »physisch« und nicht etwa als »metaphysisch« (W II 287). Nimmt man hinzu, daß Schopenhauer zugleich einen transzendentalen Idealismus lehrt, so stößt man auf das Problem, daß sich bald die Erkenntnis als Produkt der Materie bzw. des Gehirns, bald die Materie bzw. das Gehirn als Produkt der Erkenntnis darbietet: »Der Behauptung, daß das Erkennen Modifikation der Materie ist, stellt sich also immer mit gleichem Recht die umgekehrte entgegen, daß alle Materie nur Modifikation des Erkennens des Subjekts, als Vorstellung desselben, ist.« (W I 58; vgl. a. W II 25 u. 339)17
Stellt man in Rechnung, daß sich der Wille als Ding an sich in der empirischen Wirklichkeit als Wille zum Leben manifestiert, so ist nachvollziehbar, daß Schopenhauer das Gehirn und seine Leistung, die Erkenntnis, unter diesem Gesichtspunkt als Mittel zur »Erhaltung des Individuums und Fortpflanzung des Geschlechts« (W I 202; vgl. a. W I 204 u. W II 327) charakterisiert. Da nun die Erkenntnis durch das Gehirn und dieses – als Erscheinung desselben – durch den Willen bedingt ist, könnte man sagen, daß sie im Verhältnis zum Gehirn bzw. zum Leib sekundär und im Verhältnis zum Willen als Ding an sich gar nur tertiär sei. In diesem Sinn hebt Schopenhauer hervor: »Ich setze also erstlich den Willen, als Ding an sich, völlig Ursprüngliches; zweitens seine bloße Sichtbarkeit, Objektivation, den Leib; und drittens die Erkenntniß, als bloße Funktion eines Theils dieses Leibes.« (N 220; vgl. a. W II 234, 238, 287, 302, 320, 322 u. 324) Daß die Erkenntnis dem Willen untergeordnet ist, zeigt sich in mehrfacher Hinsicht: Zum einen dient sie ihm als bloße »μηχανη« (W I 202 u. 204), und zum andern hängt sie dergestalt von ihm ab, daß er sie bald fördert (vgl. W II 257 ff.), bald stört und verfälscht (vgl. W II 164 ff. u. 250 ff.). Demnach wäre das Gehirn – metaphysisch betrachtet – eine Erscheinung des Willens, genauer gesagt, eine Erscheinung, in der sich dieser »als ein Erkennenwollen« (W II 302) objektiviert.
Was das Verhältnis des Gehirns zum übrigen Leib bzw. Organismus anbelangt, so stellt es sich als überaus komplex dar. Zunächst betont Schopenhauer, daß beide durch einander bedingt sind: »Demnach ist allerdings das Gehirn, mithin der Intellekt, unmittelbar durch den Leib bedingt, und dieser wiederum durch das Gehirn, jedoch nur mittelbar, nämlich als Räumliches und Körperliches, in der Welt der Anschauung, nicht aber an sich selbst, d. h. als Wille.« (W II 303) Gemeint ist damit, daß das Gehirn – als »Efflorescenz des Organismus« (W II 322) – physisch vom Leib abhängt18, während der Leib umgekehrt in kognitiver Hinsicht – das heißt, um erkannt zu werden – auf das Gehirn angewiesen ist. Setzt man für das Gehirn das, was es leistet, die Vorstellung, ein, so ergibt sich: »Allerdings setzt […] das Daseyn des Leibes die Welt der Vorstellung voraus; sofern auch er, als Körper oder reales Objekt, nur in ihr ist: und andererseits setzt die Vorstellung selbst eben so sehr den Leib voraus; da sie nur durch die Funktion eines Organs desselben entsteht.« (W II 323) Angesichts der wechselseitigen Bedingtheit der Vorstellung einerseits und des Gehirns bzw. Leibes anderseits, die Schopenhauer an dieser Stelle beschreibt, erhob Zeller 1873 den bekannt gewordenen Einwand, es liege ein Zirkel vor: »Wir befinden uns demnach in dem greifbaren Zirkel, daß die Vorstellung ein Produkt des Gehirns und das Gehirn ein Produkt der Vorstellung sein soll – ein Widerspruch, für dessen Lösung der Philosoph auch nicht das Geringste gethan hat.«19 Freilich war Zeller entgangen, daß Schopenhauer die Abhängigkeit von Vorstellung und Gehirn jeweils in einem anderen theoretischen Zusammenhang und nicht etwa im Rahmen eines einheitlichen Ansatzes diskutiert, so daß kein Zirkel entsteht, sondern lediglich zwei unterschiedliche Perspektiven – eine subjektive und eine objektive bzw. eine transzendentale und eine anthropologische – vorliegen und sich dabei ergänzen. Dies aber bedeutet, daß die von Zeller geübte Kritik ihr Ziel verfehlt.
Es war bereits davon die Rede, daß der Satz vom zureichenden Grunde in vier Gestalten auftritt, die mit der apriorischen Korrelation von Subjekt und Objekt sowie dem Verhältnis der gesetzmäßigen Abhängigkeit, in dem die Objekte bzw. Vorstellungen der jeweiligen Klasse zueinander stehen, eine gemeinsame Wurzel aufweisen. Verweist jedes Objekt auf ein anderes, so läuft dies für Schopenhauer auf die »Dependenz, Relativität, Instabilität und Endlichkeit der Objekte unsers in Sinnlichkeit, Verstand und Vernunft, Subjekt und Objekt befangenen Bewußtseyns« (G 175; vgl. a. W I 34, 65 f. u. 221) hinaus, und es bedeutet darüber hinaus, daß es kein Objekt gibt, das als letzter Grund oder Absolutum in Frage käme (vgl. G 171 u. P I 92). Was nun die vier Gestalten des Satzes vom zureichenden Grunde anbelangt, so unterscheidet Schopenhauer zwischen dem Satz vom zureichenden Grunde des Werdens, des Erkennens, des Seins sowie des Handelns, von denen sich eine jede auf eine andere Klasse von Objekten bzw. Vorstellungen bezieht.
Der Satz vom zureichenden Grund des Werdens läuft letztlich auf das »Gesetz der Kausalität« oder – in modernerer Terminologie – das Kausalitätsprinzip hinaus. Schopenhauer formuliert es wie folgt: »Wenn ein neuer Zustand eines oder mehrerer realer Objekte eintritt; so muß ihm ein anderer vorhergegangen seyn, auf welchen der neue regelmäßig, d. h. allemal, so oft der erstere daist, folgt. Ein solches Folgen heißt ein Erfolgen und der erstere Zustand die Ursache, der zweite die Wirkung.« (G 49) Dabei handelt es sich – nach Schopenhauer – um ein apriorisches bzw. transzendentales Gesetz (vgl. G 56, N 289, E 66 f. sowie W II 46 u. 48), das heißt, um eines, dessen Geltungsgrund nicht in der Erfahrung liegt, sondern das vielmehr eine Bedingung der Möglichkeit der Erfahrung darstellt (vgl. W I 40 u. 553 sowie E 189). Dieses Prinzip bezieht sich allein auf den Bereich der empirischen Wirklichkeit bzw. der Welt als Vorstellung, und es beinhaltet, daß jedes Ereignis in diesem Bereich notwendig nach einer kausalen Regel durch ein anderes, ihm vorhergehendes Ereignis hervorgebracht wird. Indem Schopenhauer jede Wirkung als notwendige Folge einer Ursache betrachtet, nimmt er eine deterministische Position ein, die freilich nur für die empirische Wirklichkeit – also das Verhältnis empirischer Gegenstände bzw. Ereignisse zueinander – gilt. Eine über die Veränderungen in der empirischen Wirklichkeit hinausreichende Geltung kommt ihm, wie Schopenhauer hervorhebt, nicht zu. Damit erstreckt sich das »Gesetz der Kausalität« weder auf die Materie noch auf die Naturkräfte, aber auch das Ding an sich als metaphysische Entität, der Satz vom zureichenden Grunde sowie die apriorische Korrelation von Subjekt und Objekt als transzendentale Strukturen sind ihm nicht unterworfen.
Zwar legt Schopenhauer im § 21 der Abhandlung Ueber die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde eine ausführliche Erläuterung der »Apriorität des Kausalitätsbegriffes« vor, doch bereits in dieser Formulierung deutet sich an, daß er dort allenfalls die Apriorität der Kategorie der Kausalität, nicht aber jene des Gesetzes der Kausalität einsichtig macht. Er argumentiert, daß die Kategorie der Kausalität erforderlich ist, um den Übergang von der Empfindung zur empirischen Anschauung bzw. Wahrnehmung zu erklären: »Erst wenn der