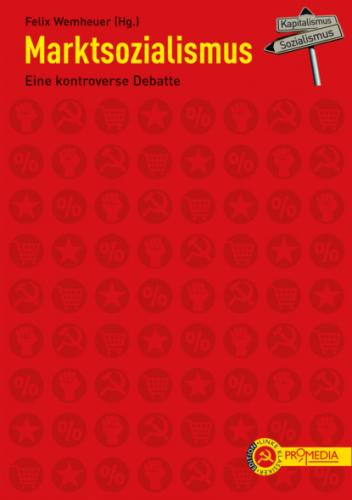Die Rolle von Computern spielte später in der sozialistischen Debatte noch eine größere Rolle. AnhängerInnen eines „Computer-Sozialismus“ argumentieren heute, dass die Herausforderung durch die „Kalkulationsdebatte“ Geschichte sei, weil die großen Rechnerkapazitäten und Digitalisierung eine zentrale Planwirtschaft „on demand“ ermöglichen würden.39
Kapitel 3: Das „Neue Ökonomische System der Planung und Leitung“ (NÖSPL) in der DDR
Die Einführung des NÖSPL war ein ambitionierter Versuch der SED-Führung um Ulbricht, den Rückstand der ostdeutschen Industrie in Technologie und Produktivität gegenüber der Bundesrepublik aufzuholen. Die Partei vertrat ab 1963 eine neue ökonomische Agenda, die sie selbst während der ersten Reformwelle 1957 teilweise als „Revisionismus“ gebrandmarkt hatte. Zu Beginn verband Ulbricht die ökonomischen Reformen mit einer Aufwertung der Jugend, die zuvor von der Partei oft nur als Objekt der Erziehung angesehen worden war. Außerdem bekamen Kulturschaffende aus Kunst, Literatur und Film mehr Freiräume, um Widersprüche der sozialistischen Gesellschaft kritisch zu thematisieren. Politische Reformen wie in der Tschechoslowakei 1968 strebte Ulbricht nicht an, sondern agierte eher wie ein „aufgeklärter Monarch“, der sich mit ExpertInnen umgab.40 Die kulturelle Öffnung nahm ein jähes Ende mit dem berühmt-berüchtigten „Kahlschlag-Plenum“ des Zentralkomitees der SED im Dezember 1965. Eine Koalition um Honecker setzte eine Verbotswelle von Literatur und Filmen durch und belastete damit das Verhältnis zu den Kulturschaffenden schwer.41
Der in diesem Buch abgedruckte Beschluss des ZK der SED von 1963 argumentiert, dass es vor dem Bau der Berliner Mauer 1961 nicht möglich gewesen sei, ein geschlossenes ökonomisches System des Sozialismus aufzubauen. Dogmatismus innerhalb der Partei habe außerdem dazu geführt, dass ökonomische Gesetze nicht richtig angewendet werden. Als ein zentrales Problem werden „weiche Pläne“ genannt. Damit ist gemeint, dass Betriebe versuchen, gegenüber den Behörden Planziele herunterzuhandeln, um sie leichter erfüllen zu können. Selbst bei Nichterfüllung müssten sie mit keinen schmerzhaften Konsequenzen rechnen.
Das ZK-Dokument kritisiert außerdem, das bisherige Anreizsystem führe dazu, dass viele Betriebe oft die Steigerung der Produktion oder die Senkung der Kosten zu Lasten der Qualität betreiben würden. Auch fehle Interesse daran, neue Technologien einzusetzen. Die Parteiführung beanstandet darüber hinaus, dass bei der Festlegung der Löhne und Prämien der Belegschaft und Betriebsleitungen zu wenig technisches Niveau und Produktivität berücksichtigt werde. Als Lösung wird die Schaffung eines geschlossenen Systems von ökonomischen Hebeln vorgeschlagen.
Die beiden SED-Wirtschaftsfunktionäre Erich Apel und Günter Mittag führten in einer Broschüre 1964 im Detail aus, wie ökonomische Hebel (Kosten, Preis, Umsatz und Gewinn, Kredit, Lohn und Prämie) zur Steigerung der Produktivität eingesetzt werden sollten. Ziel sei ein geschlossenes System von Anreizen, sodass Betriebsleitungen und Belegschaft bei guter Qualität mehr Einkommen und Ressourcen bekommen sowie schlechte Arbeit zur Senkung der Einkommen führe. Das Wertgesetz gelte auch in der sozialistischen Warenproduktion. Im Unterschied zum Kapitalismus wirke es aber nicht spontan, sondern müsse planmäßig von Staat und Betrieben angewendet werden.
Apel und Mittag meinten mit der „Anwendung des Wertgesetzes“ in der Planwirtschaft, dass der gesellschaftliche Zeitaufwand zur Herstellung einer Ware genau erfasst werden müsse, um eine realistische Rechnungsführung der Betriebe und eine richtige Anwendung der Hebel möglich zu machen. Im Rahmen der NÖSPL-Reformen sollte sich vor allem der Austausch für Industrieprodukte am Wertgesetz orientieren, während Apel und Mittag ausdrücklich betonten, dass die stark subventionierten Preise für die Grundversorgung im Konsum nicht erhöht werden sollten.42 Diese Auffassung war während der zweiten Reformwelle im sowjetischen Lager weit verbreitet.
Marx hatte argumentiert, dass in der historisch spezifischen kapitalistischen Produktionsweise Arbeitsprodukte auf dem Markt Wert- und Warenform annehmen würden. Der Wert einer Ware werde durch die gesellschaftliche Durchschnittsarbeitszeit zu ihrer Herstellung bestimmt. Nach orthodoxer Interpretation von Marx findet der Austausch von Waren im Kapitalismus basierend auf dem Wertgesetz statt.43 Es ist allerdings unter marxistischen ÖkonomInnen umstritten, ob laut Marx sich der Wert einer einzelnen Ware überhaupt messen lässt oder ob sich der Wert nur im Austausch von Waren auf dem Markt realisieren kann. Besonders die Strömung der sogenannten „Wertkritik“ hält den Wert als Verkörperung abstrakter Arbeit für die Grundkategorie des Kapitalismus, der überhaupt keine alternative sozialistische „Anwendung“ möglich mache.44
In der DDR konnten sich insgesamt die hohen Erwartungen der Parteiführung um UIbricht nicht erfüllen, die mit der Reform-Agenda verbunden waren. Schon 1965 mussten die Reformkräfte Abstriche von ihrem Programm machen – wegen des Widerstandes von Interessengruppen aus den Planungsbürokratien und des konservativen Parteiflügels, die an dem alten System der zentralistischen Planwirtschaft festhalten wollten. Für Unmut in der Bevölkerung sorgten 1970 Versorgungschwierigkeiten mit alltäglichen Konsumgütern. 1971 stürzte der Parteiflügel um Honecker mit Unterstützung der sowjetischen Regierung Ulbricht und die neue Führung verkündete die sogenannte „Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik“. Faktisch konnten der Ausbau der Sozialleistungen und das ambitionierte Wohnungsbauprogramm immer weniger von der wirtschaftlichen Entwicklung getragen werden. Der Weg führte in den 1980ern in Stagnation und Schuldenkrise. Heute gibt es einige linke Forscher, die in den NÖSPL-Reformen die letzte Chance zur Rettung der DDR sehen. Andere sind hingegen der Meinung, dass die Fehlanreize der zentralen Planwirtschaft nicht überwunden werden konnten.45
Kapitel 4: Debatte um das jugoslawische Modell
Der jugoslawische Weg übte in den 1960er-Jahren eine große Anziehungskraft auf linke sozialdemokratische Kreise im Westen und auch in der „Dritten Welt“ aus. Nach dem Bruch mit der Sowjetunion 1948 hatte sich Jugoslawien zu einem der führenden Staaten der „Blockfreien-Bewegung“ entwickelt, die für eine Alternative zur Teilung der Welt in ein US-amerikanisches und sowjetisches Lager stand. In den 1950ern führte die Regierung unter Tito in ausdrücklicher Abgrenzung zum sowjetischen Modell in den Fabriken schrittweise eine „Arbeiterselbstverwaltung“ ein. Die Belegschaft sollte ihr Management selbst wählen, in wichtigen Angelegenheiten der Betriebe ein Mitspracherecht haben und an Gewinnen beteiligt werden. Die Vorgaben der Planungsbehörden wurden abgebaut und Betriebe sollten gegeneinander konkurrieren. Die Parteiführung sah „Arbeiterselbstverwaltung“ als wichtigen Schritt zur Vergesellschaftung der Produktionsmittel in Abgrenzung zum Konzept der Verstaatlichung im sowjetischen „etatistischen“ Modell.
Dieses Buch dokumentiert einen Text des jugoslawischen Soziologen Rudi Supek (1973), der ein Anhänger dieses Modells war und eine Ausweitung der Selbstverwaltung befürwortete. Supek gehörte seit 1966 zur Redaktion der Zeitschrift Praxis. Die „Praxis-Gruppe“ stand für einen „humanistischen Marxismus“ und hatte über Jugoslawien hinaus Einfluss auf die westliche Neue Linke. Supek wendet sich gegen Strömungen in der jugoslawischen Partei, die entweder zu einem etatistischen Modell zurückwollen oder Reformen im Sinne eines wirtschaftlichen Liberalismus anstreben. Supek führt gegen beide Strömungen Marx ins Feld. Er zitiert Marxens Kritik an der Arbeitsteilung in der bürgerlichen Gesellschaft, die die Menschen in entfremdete Teilindividuen als BürgerInnen, Produzierende und Konsumierende spalte. Die Prinzipien der Selbstverwaltung müssen daher nicht nur in der Produktion angewendet, sondern auch auf die Verteilung und den Konsumbereich ausgeweitet werden. Der Mehrwert, den die ArbeiterInnen produzieren, dürfe nicht zu einer Form unabhängiger wirtschaftlicher Macht werden, die eine privilegierte Gruppe kontrolliere. Um dies zu verhindern, sollten die Organe der direkten Demokratie auf den verschiedenen Ebenen der Gesellschaft über die Verwendung entscheiden können. Die „Praxis-Gruppe“ diskutierte die Selbstverwaltung vor allem im Zusammenhang