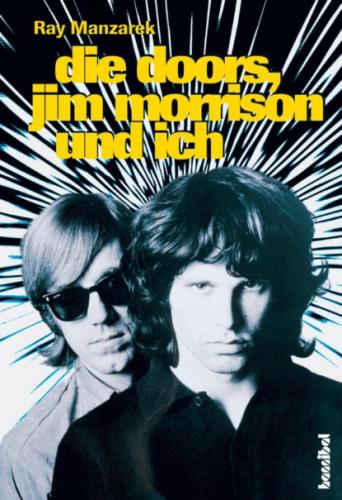Das Radio spuckte eine „Hitsingle“ nach der anderen aus, aber Popsongs waren das nicht. Es waren Bluesklassiker! Brandneu! Frisch aus dem Aufnahmestudio; das Vinyl kam noch fast warm aus dem Preßwerk und direkt in die Radiosender, die es augenblicklich über den Äther schickten, bis es aus dem Lautsprecher in mein überhitztes Hirn gelangte. Dionysos hatte von mir Besitz ergriffen … über die Ohren!
Und so ging es nonstop weiter. „Hier ist die neue Platte von Howlin’ Wolf.“ Dann kam „Smokestack Lightnin’“. Die Nummer ging mir durch und durch, vor allem wegen des repetitiven Riffs. Kein einziger Akkordwechsel! Immer wieder ein und derselbe Akkord. Er hämmerte auf das innere Rhythmuszentrum. Immer wieder. Funky, düster, rauh, böse. Immer wieder. Derselbe Akkord. Dasselbe Riff. Wieder und wieder. Jaaa … ich geriet langsam in einen tranceähnlichen Zustand. Mein Radio hypnotisierte mich. Howlin’ Wolf hatte mich voll unter seiner Kontrolle. Und dann dieser Text …
Smokestack lightning, shining just like gold.
– Howlin’ Wolf
Und dann heulte und jaulte er tatsächlich wie ein verirrter Wolf. Er trauerte um eine gescheiterte Liebe. Einsam und voller Furcht, verletzlich und doch voller Macht. Ein Mann. Ein wahrer Mensch. Was für eine Stimme.
Und was zum Teufel bedeutete dieser Text? Was ist ein Schornstein-Blitz, und warum glänzt er wie Gold? Ich weiß es immer noch nicht. Und ich finde es toll. So verdammt mysteriös. Ein Mann, der wie ein Wolf heult, und dieses Riff, das sich ein ums andere Mal wiederholt. Düstere, unvorhersehbare Wendungen der Blue Notes. Die gleichen Akkorde, die gleichen Töne. Wieder und wieder, sie brannten mir ein hypnotisches Loch in den Verstand. Ein Mantra. Ein Mantra des schwarzen Amerika. Später öffneten mir meine Studien über die Yoga-Mantras die Tür zur indischen Weisheits-Lehre und der inneren Energie der menschlichen Existenzform. Howlin’ Wolf öffnete Dionysos die Tür … mit einem Satz durch meine Ohren war er drin.
„Hier ist ein neuer Song von meinem Freund Bo Diddley“ – so kannte ich Al Bensons Stimme –, „,Who Do You Love?‘“ Und schon ging’s wieder los. Diesmal ritt ich auf dem Bo-Diddley-Beat, jenem Rhythmus der afrikanischen Urvölker, und darüber schickte Bo seine düsteren und gefährlichen Worte:
Tell me, hoodoo you love?
– Bo Diddley
Ist klar, oder? Hoodoo you love. Juju und Voodoo und Gris-gris und Hoodoo geisterten alle nach der Schule durch mein Zimmer – und durch meinen Kopf!
Und dann sprang John Lee Hooker geradewegs aus dem Radio – nach einem Werbespot für „Dixie Peach“-Haarpomade –, und er brachte seinen neuesten Hit „Boogie Chillun“. Danach sang Jimmy Reed „You got me runnin’, you got me hidin’“. Magic Sam … „I’m A King Bee“. All das kam im Radio. Topaktuell. Die Klassiker waren brandneu und schwammen in meinem Hirn herum. Das Radio war eine unglaubliche Inspiration, als ich fünfzehn, sechzehn war, einer von zweitausend Schülern der St. Rita High, für den nichts lief. Noch nie hatte mich eine rangelassen. Ob ich schon mal ein Mädchen geküßt hatte? Wie lernte man Mädchen kennen? Wie sprach man sie an? Aber im Radio glühte es geradezu. Das war reiner Sex, reine Energie, reine Power, reine Leidenschaft. Für mich war es das Größte. Liebe Freunde, das Radio rettete mir das Leben. Es rettete meine Seele.
***
Dann: Elvis Presley war im Fernsehen! Es passierte in einer Ersatzsendung für die „Jackie Gleason Hour“. Jackie Gleason guckten wir immer, das war ein Familienritual. Sid Caesar auch, sowie alle Sendungen mit Laurel und Hardy; „The Twilight Zone“. Mein Vater schaute Boxen, und ich wollte Baseball und Fußball sehen. Das waren die Fernsehgewohnheiten bei Familie Manzarek. Dann lief noch ein bißchen „Playhouse 90“ oder andere der tollen Fernsehserien der Fünfziger.
In der Sommerpause gab es Ersatzprogramm. Meine Eltern guckten aus Gewohnheit die Show von Tommy & Jimmy Dorsey, die als Band für Jackie Gleason auftraten. Und zu den Gästen in jener Woche gehörte kein Geringerer als Elvis Presley. Im amerikanischen Fernsehen! Ich war in einem anderen Zimmer, las oder holte mir einen runter. So eine blöde alte Bigband im Fernsehen interessierte mich überhaupt nicht, ich war ein Blues Boy … und dann rief meine Mutter nach mir. „Raymond! Raymond, komm mal her! Den hier mußt du dir ansehen, das ist ein ganz cooler Typ. Der wird dir gefallen.“ Und ich hörte aus dem Fernseher: „One for the money, two for the show, three to get ready, now go cat go!“ Ich sprang auf, rannte ins Wohnzimmer, sah zum Bildschirm, und da war Elvis und sang „Blue Suede Shoes“. Ein Killer! Ich war hin und weg. Endlich ein Weißer, der das brachte. Den Blues. Ich hatte vorher all den Schwarzen zugehört und so sein wollen wie sie. Ich versuchte, sie zu imitieren, spielte Muddy und Jimmy Reed, John Lee Hooker und Howlin’ Wolf auf dem Klavier nach, so gut ich konnte – und ich war noch nicht sehr gut –, und dann war da plötzlich ein Weißer, der es im Fernsehen krachen ließ. Er trug einen cremefarbenen Anzug, ein dunkles Hemd und einen cremefarbenen Schlips. Er sah sogar so aus, als ob er tatsächlich blaue Wildlederschuhe anhatte. Scottie Moore spielte die Gitarre, Bill Black zupfte den Baß, und D. J. Fontana traktierte das Schlagzeug. Diese Jungs rockten wie die Teufel. Elvis sang mit dieser tiefen, vollen Stimme und wackelte geradezu dionysisch mit den Hüften. Mir fielen fast die Augen raus. Wow! „Ich hab doch geahnt, daß dir das gefallen wird“, sagte meine Mutter mit wissendem Grinsen, als der Song zu Ende war. „Aber ehrlich!“ Und dann brachte er noch einen. Und der war genauso cool und rockig. Das Coole daran war, daß es etwas Countrymäßiges hatte. Es war nicht der traurige, klagende Chicago-Sound, den ich kannte. Es war ein bißchen lockerer. Es war weiß. Elvis mit Akustikgitarre, Stehbaß, elektrischer Countryblues-Gitarre und Schlagzeug. Es war Rockabilly. Die Seele der Schwarzen war in einen weißen Mann gefahren. Der Provinzler, der Honky, konnte den Neger jetzt verstehen und respektieren. Das Paradies war in Sicht. Und die Schleusen brachen unter der Kraft des Rock ’n’ Roll!
Nachdem Elvis im Fernsehen gewesen war, eroberte Rockmusik das Radio. Little Richard spielte „Tutti Frutti“, Jerry Lee Lewis „Good Rockin’ Tonight“. Chuck Berry sang „Roll over Beethoven and tell Tchaikovsky the news!“, Fats Domino trumpfte mit „I’m Walking“ auf, Bill Haley mit „Rock Around The Clock“, Gene Vincent sang mit seinen Blue Caps „Be-bop-a-lula, she’s my baby“. Das weiße Amerika hörte solche Sounds zum allererstenmal. Die weißen US-Kids flippten aus und gingen voll in dieser neuen Sache auf. Und die Eltern wußten: „Das ist das Ende. Das ist das Ende der westlichen Zivilisation in ihrer bisherigen Form. Unsere Töchter sind nicht mehr zu bremsen. Sie hören diese wilde, verrückte Musik, in der Sex nicht nur versteckt angedeutet wird.“ Und die Jungen, die schon vorher nur Sex im Kopf gehabt hatten, wußten jetzt um die kreisenden Bewegungen eines Elvis Presley und konnten sie den Töchtern Amerikas vorführen. Wir drehten durch!
Das hatte enormen Einfluß auf mein Klavierspiel. Ich stellte meinen Bluesmen jetzt noch die Rocker zur Seite und sang aus vollem Hals bei allen Hits des Tages mit, während ich mit der Linken den Rhythmus hämmerte und mit der Rechten Glissandi und Triolen spielte. Mittlerweile war ich dem Partykeller und dem klobigen deutschen Ungetüm längst entwachsen und hatte ein besseres, anspruchsvolleres Spinettklavier im Wohnzimmer stehen. Das mußte nun allerlei aushalten. Klavierstunden gewannen bei mir bald einen ganz anderen Sinn. Ich hätte ja Bach spielen sollen – und tat das auch –, aber ich liebte nun mal die Rockmusik. Und verdammt noch mal, meine Eltern liebten sie auch. Solange ich gute Noten nach Hause brachte und meinen klassischen Musikunterricht nicht vernachlässigte, konnte ich alles spielen, was mir in meinen verrückten Teenagergedanken herumspukte. Und mein fieberndes Hirn dachte an nichts anderes als an Rock ’n’ Roll und Blues.
***
1958, als ich dann etwas älter war, sah ich