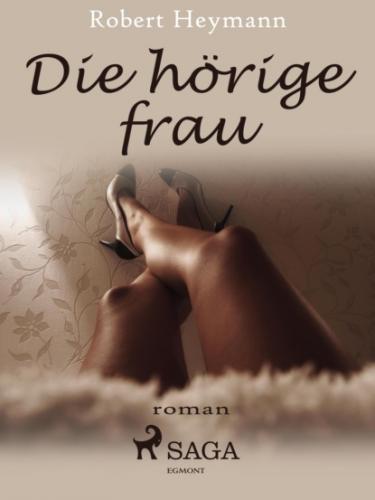Diese Frauen — „zeitzaubernd, immer unterhaltend“, erregten immer von neuem durch ihre Schicksale das Interesse der westlichen Welt.
Eine der Frauen, Mumtez Begum, eine bezaubernde Tänzerin, entfloh aus dem Palast und kam nach Bombay. Sie suchte und fand dort Unterkommen bei einem reichen und angesehenen Großkaufmann.
Aber die Rache des Maharadschas spürte sie auf, und in der Folge fand der Kaufmann den Tod, während das junge Mädchen kaum einem gleichen Schicksal entging.
Dann kreuzte ein anderes, scheinbar ebenfalls bezauberndes Wesen seinen Weg, und wieder folgte der Exmaharadscha diesem Irrlicht.
Ein ungestümes Kurmachen, und Nancy Ann, ein wohlhabendes junges Mädchen der besten Kreise aus Seattle, Washington, folgte dem indischen Fürsten. Er brachte sie nach Indien, wo sie ihre Religion ablegte und Hindu wurde, um ihn heiraten zu können.
Die Hindupriester veranstalteten allenthalben empörte Versammlungen, in denen gegen das Eindringen einer Christin in ihre Kreise protestiert wurde. Das Volk des Fürsten war derartig aufgebracht, daß der Maharadscha es für besser hielt, nach der Hochzeit sofort mit der jungen Frau nach Paris abzureisen. Hier strengte Sowkabaia Pandarination Rajpurkar, eine vornehme Indierin, Klage gegen den früheren Maharadscha auf Herausgabe eines großen Teiles ihres Vermögens an. Die Affäre kam in Bombay zur Verhandlung, und es wurde behauptet, daß der Fürst sie und ihre Tochter elf Jahre hindurch gefangen gehalten hätte, daß in den Verließen des Palastes die beiden Frauen der unwürdigsten Behandlung ausgesetzt worden wären, und daß der Fürst, während er sie gefangen hielt, ihr Vermögen an sich gerissen hätte.
Eigenartig und fremd muten uns diese Geschichten an. Verschleierte Andeutungen von unglaublichen Greueltaten, die hinter den eifersüchtig bewachten Mauern der indischen Fürstenschlösser stattgefunden haben, laufen von Zeit zu Zeit durch die ganze Welt.
Die Geschichte, die die unglückliche Sowkabaia Rajpurkar erzählte, hört sich wie ein Märchen aus „Tausend und einer Nacht“ an. Im Jahre 1915 ließ der Maharadscha Einladungen zur Feier der Geburt des Kindes einer seiner Frauen ergehen — und unter den Eingeladenen befand sich Sowkabaia Pandarination Rajpurkar, eine indische Fürstin, die dieser Einladung mit Sorgen und trüben Vorahnungen Folge leistete. Hunderte von vornehmen Indiern nahmen an dem wundervollen, phantastischen Fest teil. —
Am nächsten Tage wurden Sowkabaia und ihre Tochter in den Kerker geworfen. Vergebens protestierte die Mutter und verlangte den Fürsten zu sprechen. Erst geraume Zeit später wurde sie vor diesen geführt, der ihr lächelnd den Preis ihrer Freiheit mitteilte.
„Ich wünsche deine Tochter. Sie ist schön, und ich muß sie haben. Fügt sie sich meinen Wünschen, so wirst du frei sein, und sie wird alle Reichtümer, alle Vergnügungen haben, die sie sich nur wünscht.“
Vergebens verlangte die Indierin freigelassen zu werden. Lange Jahre grausamer Kerkerschaft folgten, bis sich im Jahre 1926 die britische Regierung der Angelegenheit annahm. Der Vizekönig verlangte die sofortige Freilassung der beiden Frauen. Als Sowkabaia Rajpurkar mit ihrer Tochter nach mehr als zehnjähriger Abwesenheit in ihr heimatliches Schloß zurückkam, fand sie, daß alle ihre Kostbarkeiten, all ihr Vermögen verschwunden war — in die Hände des Maharadschas.
Wir werden noch eine Reihe von Fällen moderner weiblicher Sklaverei bringen können. Hier möge ein kurzer Rückblick in das Mittelalter gestattet sein, um eine Form der weiblichen Hörigkeit zu zeichnen, für die die heutige Zeit ebensowenig Verständnis mehr besitzen dürfte wie für den despotischen Maharadscha.
Hörigkeit kann unter dem Einfluß der Geschlechtlichkeit ungeheure Formen annehmen. Aber hier, im Unnatürlichen, müssen wir die Begriffe der einzelnen Zeitalter auseinanderhalten. Ewig ist das Lob von der Tugend der Frau. Gestern las man für Tugend Treue, restlose Hingabe — heute liest man Selbstherrlichkeit und (oft genug) baren Unsinn für einen Begriff, der alt ist wie das Menschengeschlecht.
Nachfolgend das Beispiel eines ideellen weiblichen Masochismus.
„Der Markgraf Gualtieri liebte ein einfaches Mädchen, er war bereit, es zu heiraten. Doch er wollte ihre unbedingte Unterwerfung (lies: Hingabe) erproben.
Er fragt Griseldis, ehe er um das arme, schöne Bauernmädchen wirbt, ob sie immerdar bestrebt sein wolle, nur ihm zu Gefallen zu leben, und über nichts, was er auch sagen und tun möge, erzürnen, sondern ihm immerdar zu gehorchen. Als sie ihm Demut und Unterwürfigkeit gelobt hat, läßt er sie vor ihres Vaters Hütte „in Gegenwart seiner ganzen Begleitung und aller übrigen Personen“ völlig nackend auskleiden und in neue köstliche Gewänder hüllen. Obwohl die junge Mutter dann ihr erstgeborenes Kind hergeben muß und glaubt, es werde dem Tode geweiht, lebt sie mit dem Markgrafen Gualtieri jahrelang in glücklicher Ehe und gebiert ihm das zweite Kind, den Sohn. Auch nach dessen gleichartiger Entfernung bleibt sie des Gatten getreues und liebevolles Eheweib. Als sie schließlich von ihm verstoßen wird und so, wie sie gekommen ist, das Schloß verlassen muß, ist sie bereit, völlig nackt sich zu entfernen, wenn Gualtieri es verlangt. Aber zum Lohne für ihre ihm zugebrachte Jungfräulichkeit, die sie nicht wieder mitnehmen kann, bittet sie, ihr ein einziges Hemd zu belassen, was der Gatte gewährt. Schließlich verlangt er, daß Griseldis seiner vermeintlichen jungen Braut das Hochzeitsfest in seinem Schlosse zubereitet, wozu die Herrichtung des ehelichen Beilagers gehört, und daß die verstoßene Gattin in grobem Gewande die Nebenbuhlerin als ihre Gebieterin willkommen heißt, ja auf Gualtieris Fragen ihre Schönheit und ihren Anstand preist, sogar für sie bittet, es möchten ihr die Stiche im Herzen, die sie selber erlitten hat, erspart bleiben. Griseldis liebt ihren Mann vom ersten Blick bis zuletzt mit größter Zärtlichkeit. Aus hingebender Liebe zu ihm erträgt sie alle Leiden ohne Murren und mit heiterer Seele. Trotz aller Qualen, die sie überstanden hat, wird sie schließlich für ihr ganzes künftiges Leben die glücklichste Frau. Auch der Markgraf liebt Griseldis von ganzem Herzen. Nur aus Liebe zu ihr fühlt er sich getrieben, ihre Zuneigung zu ihm auf diese seltsame Weise zu erproben.
Griseldis sagt:
„Was mein herr tut, ist wolgetan,
da hab’ ich keinen Zweifel an.
alles, was er von mir begert,
wirt frölich er von mir gewert,
wolauf, nun wöllen wir hinein
zum allerliebsten herren mein!“
Masochismus der Frau?
Sicher.
Die Frau ist eben masochistisch veranlagt, sie muß es sein, wie könnte sie sonst das ungeheuerliche Martyrium der Mutterschaft ertragen?
Da ist noch der Roman Genovefas, wie Gustav Schwab ihn überliefert. Genovefa hatte erfahren, daß sie (auf Befehl des Gatten, der an ihre Untreue glaubte) sterben sollte. Da erschrak die arme Gräfin so, daß sie fast in Ohnmacht sank. Als sie wieder zu Sinnen gekommen, fing sie laut an zu weinen und zu beten und rief: „Ach, mein Gott, hilf mir! Erlöse mein Kind und mich vom grimmigen Tode!“ Dann sprach sie zu dem Mägdlein: „Mein liebes Kind, geh doch schnell in mein Zimmer und bring mir Papier, Feder und Tinte. Für deine Mühe nimm dir von meinen Kleinodien, so viel dir beliebt. Da hast du den Schlüssel zu Allem!“ Das Mädchen brachte das Verlangte, und nun schrieb Genovefa einen Brief des folgenden Inhalts: „Gnädiger Herr, herzgeliebter Gemahl! Da mir zu Ohren gekommen ist, daß ich auf Euren Befehl sterben soll, so wollte ich Euch mit diesen Zeilen noch Gute Nacht sagen und einen freundlichen Abschied von Euch nehmen. Ich will gern sterben, wenn Ihr es befehlt, obgleich es mich bitter kränkt, daß Ihr mich, die Unschuldige, zum Tode verurteilt. Die Ursache, warum ich sterbe, ist die, daß ich meine Euch gelobte Treue nicht brechen und dem schändlichen Golo, Eurem Hofmeister, nicht willfahren wollte. Doch messe ich Euch, meinem Herrn, keine andere Schuld zu, als