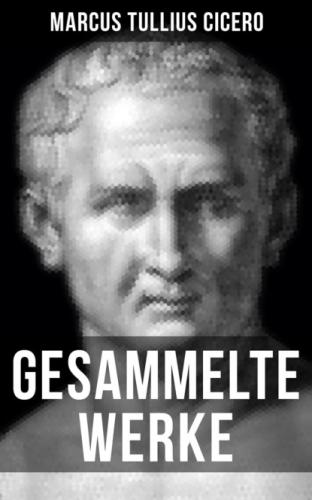Kap. XIII. (§ 39.) Dem Ansehn der Vernunft folgend, will ich dasselbe thun. Ich werde, so viel ich kann, die Streitfragen vermindern und alle jene einfachen Ansichten, die nichts von Tugend mit sich führen, für nicht zur Philosophie gehörig ansehn; zunächst also die des Aristipp und aller Cyrenaiker, die sich nicht scheuen, das höchste Gut in diejenige Lust zu setzen, welche wesentlich in der Sinnenlust besteht, und welche die Schmerzlosigkeit verwerfen. (§ 40.) Sie erkennen nicht, dass, so wie das Pferd zum Laufen, der Stier zum Pflügen, der Hund zum Aufspüren, so der Mensch, wie Aristoteles sagt, zu zweierlei von Natur bestimmt ist: zum Erkennen und zum Handeln, gleich einem sterblichen Gotte. Sie wollen vielmehr, dass dieses göttliche Geschöpf wie ein träges und schwaches Vieh nur zur Weide und zur Lust des Zeugens geboren sei; das Verkehrteste, was sich denken lässt. (§ 41.) So viel gegen Aristipp, welcher diejenige Lust, die allein wir Alle so nennen, nicht blos für die höchste, sondern auch für die einzige erklärt. Ihr habt allerdings eine andere Ansicht, indess hat Epikur, wie gesagt, Unrecht; weder die Gestalt des menschlichen Körpers, noch die vortreffliche Beschaffenheit seines Geistes deuten dahin, dass der Mensch nur allein dazu geboren sei, um die Lust zu geniessen. Ebenso wenig kann man dem Hieronymus beistimmen, dem die Schmerzlosigkeit für das höchste Gut gilt, wie auch Ihr manchmal oder vielmehr nur zu oft behauptet; denn wenn der Schmerz das Uebel ist, so genügt nicht die Freiheit vom Uebel zum glücklichen Leben. Dies durfte eher ein Ennius sagen:
»Dem geht es zu gut, der an keinem Uebel leidet.«
Wir finden das glückliche Leben nicht in der blossen Abhaltung des Uebels, sondern in der Gewinnung des Guten und suchen es nicht im Nichtsthun, mag man sich dabei freuen, wie Aristipp, oder schmerzlos sein, wie Hieronymus sagt, sondern in der Thätigkeit und Betrachtung. (§ 42.) Dasselbe lässt sich gegen das höchste Gut des Karneades sagen, was er weniger aus Ueberzeugung aufstellte, als um den Stoikern, mit denen er Krieg führte, zu widersprechen; indess ist es doch der Art, dass, wenn man es der Tugend hinzufügt, es auf Beistimmung Anspruch machen und das glückliche Leben vollständig darstellen kann, um welches es hier sich handelt. Denn wenn man mit der Tugend die Lust verbindet, die für sich allein von der Tugend nur gering geschätzt wird, oder die Schmerzlosigkeit, die zwar frei vom Uebel, aber doch nicht das höchste Gut ist, so macht man einen Zusatz, der zwar nicht zu billigen ist, von dem ich aber nicht einsehe, weshalb man diese Verbindungen nur so schwach und eingeschränkt eintreten lässt. Beinahe scheint es, als müsste das erst erkauft werden, was der Tugend zugesagt wird; deshalb wird ihr zunächst nur das Werthloseste zugefügt; dann immer nur Einzelnes, statt dass sie Alles, was die Natur als das Erste gebilligt hat, mit der Sittlichkeit hätten verbinden sollen. (§ 43.) Wenn Aristo und Pyrrho dergleichen überhaupt für nichtig erklären, weil nach ihnen zwischen der kräftigsten Gesundheit und der schwersten Krankheit kein Unterschied besteht, so hat man mit Recht schon längst aufgehört, gegen sie zu streiten. Nach ihnen soll in der einen Tugend alles Andere enthalten sein; sie beraubten sie deshalb aller Auswahl der Dinge und liessen ihr nichts, woraus sie entstehn und worauf sie sich stützen könnte; damit vernichteten sie gerade die Tugend, die sie so heftig in Schutz nahmen. Herillus bezog dagegen Alles auf die Wissenschaft; damit erfasste er wohl ein einzelnes Gut, aber weder das beste noch das, wonach man das Leben zu leiten vermag. Deshalb ist seine Ansicht längst verworfen worden, denn seit Aristipp hat man nicht mehr darüber gestritten.
Kap. XIV. So bleibt nur Ihr noch übrig; denn mit den Akademikern ist schwer zu streiten, da sie nichts fest behaupten, sondern, gleichsam an der sichern Erkenntniss verzweifelnd, nur dem folgen, was als wahrscheinlich erscheint. (§ 44.) Epikur macht dagegen mehr zu schaffen, weil seine Lust von doppelter Art ist, und weil nicht blos er, sondern auch seine Freunde und viele Spätere seine Ansicht vertheidigt haben, und ich mir nicht erklären kann, wie auch das Volk, was zwar das geringste Ansehn, aber die grösste Macht hat, es mit denselben halten kann. Wenn diese Ansichten nicht widerlegt werden, so muss man alle Tugend, alle Ehrbarkeit, alles wahre Lob aufgeben. So bleibt also nach Beseitigung der andern Ansichten nicht mehr der Kampf zwischen mir und Torquatus übrig, sondern der zwischen der Tugend und der Lust. Auch Chrysipp, ein Mann von Scharfsinn und Fleiss, verschmäht diesen Kampf nicht und verlegt die ganze Entscheidung über das höchste Gut in eine Vergleichung beider. Ich meine aber, dass, wenn ich gezeigt haben werde, dass das Sittliche ein Gegen stand ist, der um seiner eignen Kraft und um seiner selbst willen zu erstreben ist, dann Euer ganzes Lehrgebäude zusammenfällt. Deshalb werde ich zuerst kurz, wie es die Zeit verlangt, feststellen, welcher Natur das Sittliche ist, und dann zu alle dem, so weit mich mein Gedächtniss nicht verlässt, übergehn, was Du, Torquatus, gesagt hast. (§ 45.) Ich verstehe also unter dem Sittlichen das, was nach Abzug alles Nutzens, ohne allen Lohn und Vortheil, um seiner selbst willen mit Recht gelobt werden kann. Seine Beschaffenheit kann nicht sowohl durch die hier gegebene Definition, obgleich vielleicht ein wenig, als vielmehr durch das übereinstimmende Urtheil Aller und aus den Bestrebungen und Thaten der besten Menschen ersehen werden, die gar Vieles nur aus dem einen Grunde verrichten, weil es sich ziemt, weil es recht, weil es sittlich ist, wenn auch kein Vortheil dabei abgesehen werden kann. Denn die Menschen unterscheiden sich neben vielem Andern vorzüglich dadurch von den Thieren, dass die Natur sie mit Vernunft begabt hat und dass sie einen scharfen, kräftigen Geist besitzen, der Vieles schnell mit einem Male übersehen kann, der gleichsam ausspürend sowohl die Ursachen wie die Folgen der Dinge erkennt, Aehnlichkeiten herausfindet, das Getrennte vereinigt, an das Gegenwärtige das Kommende knüpft und den ganzen Zustand des spätern Lebens zusammenfasst. Diese Vernunft lässt die Menschen einander aufsuchen und in Natur, Rede und Verkehr übereinstimmen. Sie beginnen mit der Liebe zu den Ihrigen und zu den Hausgenossen, gehn dann weiter und fügen sich erst der Gesellschaft ihrer Mitbürger und dann der aller Menschen an. So erinnert sich der Mensch, wie Plato dem Archytas schrieb, dass er nicht blos für sich selbst, sondern auch für das Vaterland und die Seinigen geboren ist, und dass für ihn selbst nur ein kleiner Theil dabei übrig bleibt. (§ 46.) Dieselbe Natur hat dem Menschen die Begierde nach der Erkenntniss des Wahren eingegeben, wie dann am leichtesten bemerkt werden kann, wenn man frei von Sorgen, sogar nach der Erkenntniss der Vorgänge am Himmel verlangt. Von diesen Anfängen ausgehend, liebt man die Wahrheit überall, d.h. das Zuverlässige, Einfache und Feste, und hasst das Eitle, Falsche und Trügerische, wie allen Betrug, Meineid, alle Bosheit und alles Unrecht. Diese Vernunft hat etwas Weites und Grossartiges in sich selbst, was mehr zum Befehlen wie zu dem Gehorchen eingerichtet ist; sie achtet Alles, was den Menschen treffen kann, nicht blos für erträglich, sondern für leicht; sie ist ein Hohes und Erhabenes, was nichts fürchtet, vor Niemandem zurückweicht und niemals besiegt wird. (§ 47.) Diesen drei Arten des Sittlichen folgt eine vierte von gleicher Schönheit und aus jenen dreien gebildet; in dieser wohnt die Ordnung und Mässigkeit. Wenn ihre Aehnlichkeit in der Schönheit und Würde der Formen erkannt ist, so erfolgt der Uebergang zum Anstand im Sprechen und Handeln; denn in Folge jener drei rühmlichen Eigenschaften scheut sie jede Dreistigkeit, wagt sie Niemanden durch freche Worte oder Handlungen zu verletzen und fürchtet jede unmännliche Handlung und Rede.
Kap. XV. (§ 48.) Damit hast Du, mein Torquatus, das Bild der Sittlichkeit nach ihrem ganzen Inhalt und ihrer Vollendung; sie ist ganz in jenen vier Tugenden enthalten, die auch Du genannt hast. Dein Epikur sagt, dass er nicht verstehe, was sie und wie sie nach Denen beschaffen sein sollen, welche die Sittlichkeit zum Maassstab des höchsten Guts machen, da, wenn Alles auf die Sittlichkeit bezogen werde, ohne dass eine Lust in ihr enthalten sei, man damit nur ein leeres Wortgeklingel mache (dies sind seine eignen Worte); er wisse und begreife nicht, welche Regeln unter dieser Sittlichkeit enthalten sein könnten. Nach dem Sprachgebrauch