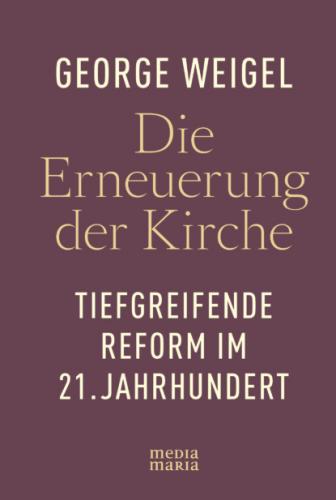Der evangelikale Katholizismus ist nicht auf die Situation der katholischen Kirche in den Vereinigten Staaten zugeschnitten, die, gemessen an den westeuropäischen Verhältnissen, vergleichsweise gut dasteht.
Der evangelikale Katholizismus ist nicht einfach eine Antwort auf die Missbrauchskrise, die das mediale Erscheinungsbild der katholischen Kirche seit 2002 geprägt hat.
Der evangelikale Katholizismus ist keine Bewegung innerhalb des Katholizismus, keine katholische Sekte und auch keine neue katholische Elite.
Der evangelikale Katholizismus ist kein Ersatz für den römischen Katholizismus, im Gegenteil: Seine Entstehung ist eng mit dem Aufkommen des modernen Papsttums verbunden, auch wenn seine weitere Entwicklung gewisse Anforderungen an ein reformiertes Petrusamt in der Kirche stellen wird.
Wenn also der evangelikale Katholizismus alles das nicht ist – was ist er dann?
Der evangelikale Katholizismus ist ein Katholizismus, der – nicht selten unter großen Schwierigkeiten – als das Ergebnis einer tiefgreifenden katholischen Reform durch das Wirken des Heiligen Geistes hervorgebracht wird. Diese Reform reagiert auf die Herausforderungen, vor die sich die christliche Orthodoxie und das christliche Leben durch den Sog der Veränderungen gestellt sehen, die die Welt seit dem 19. Jahrhundert verwandeln. Der evangelikale Katholizismus wird im ersten Teil des vorliegenden Buchs, Die Sichtweise des evangelikalen Katholizismus, genauer definiert werden. Die tiefgreifenden Reformen, die diese Sichtweise im konkreten Leben der Kirche auslösen sollten, sind das Thema des zweiten Teils, Die Reformen des evangelikalen Katholizismus.
Die katholische Kirche glaubt, dass sie durch den Willen Christi selbst in ihrer charakteristischen Form konstituiert worden ist. Deshalb erfolgt jede wirklich katholische Reform mit Bezug auf diese von Christus gegebene Konstitution oder Verfassung der Kirche (Verfassung weniger im amerikanischen als vielmehr im britischen Sinne des Wortes). In der über 2000-jährigen Geschichte des Christentums hat eine echte katholische Reform immer darin bestanden, sich auf diese Verfassung zu besinnen und Aspekte der von Christus gegebenen Form der Kirche wieder neu zur Geltung zu bringen. Das trifft auf das frühe Mittelalter und die Entwicklung des abendländischen Mönchtums zu. Das trifft auf die gregorianischen Reformen des elften Jahrhunderts zu (die übrigens ebenfalls weitreichende Folgen für die Entwicklung des politischen Lebens in Westeuropa hatten). Das trifft auf das 16. Jahrhundert zu, als das Konzil von Trient die Korruption, die die Reformation mitverursacht hatte, schonungslos offenlegte und im Zuge der Gegenreformation eine Form des Katholizismus schuf, die die Jahrhunderte überdauerte. Und das trifft auf die Absichten und zumindest in Teilen auch auf die Maßnahmen des Zweiten Vatikanischen Konzils zu.
Heute besteht die Herausforderung nicht allein darin, dass der Katholizismus sich mit feindlichen kulturellen Kräften konfrontiert sieht, die behaupten, die Kirche leiste den Männern und Frauen in einer freien, gerechten und menschlichen Gesellschaft einen schlechten Dienst. Das ist ein alter Hut. Und offen gesagt wirken solche neuen Atheisten wie Richard Dawkins, Sam Harris und der inzwischen verstorbene Christopher Hitchens eher harmlos, wenn man sie mit Nero oder Diokletian, Voltaire, Robespierre oder Bismarck, Lenin oder Mao Zedong vergleicht. Die Herausforderung besteht heute darin, das Besondere an dieser kulturellen Animosität zu erkennen: dass sie nämlich im Grunde in einer gewissen Gleichgültigkeit gegenüber der biblischen Religion wurzelt und dass sich aus dieser Gleichgültigkeit erst später, im Nachgang, die Auffassung entwickelt hat, der Gott der Bibel sei ein Feind der menschlichen Freiheit, der menschlichen Reife und des naturwissenschaftlichen Fortschritts. Im weiteren Verlauf des 21. Jahrhunderts wird diese Animosität womöglich dazu führen, dass Gläubige, einfach weil sie Gläubige sind, neuen Formen der offenen Verfolgung ausgesetzt sein werden. In den ersten beiden Jahrzehnten des neuen Jahrtausends hat sie sich jedoch vor allem darin geäußert, dass der Katholizismus an den Rand gedrängt und auf eine private Lifestyle-Entscheidung ohne jede öffentliche Relevanz reduziert worden ist. So oder so steht die nachkonziliare Kirche vor der Herausforderung, das Evangelium in einer neuen und vielleicht bisher noch nie dagewesenen kulturellen Situation zu verkünden.
Die westliche Welt, historische Heimat des Christentums, ist, um es mit dem berühmten Wort des Soziologen Max Weber zu sagen, »entzaubert« worden. Es scheint, als hätte man die Fenster und Dachluken der menschlichen Erfahrung zugenagelt und übertüncht. Eine Moderne (und Postmoderne), die der christlichen Zivilisation des Westens weit mehr zu verdanken hat, als viele Erben der kontinentalen Aufklärung es sich eingestehen wollen, hat eine nicht selten toxische öffentliche Kultur hervorgebracht, die zunehmend christophobe Züge annimmt, um einen Begriff des orthodoxen Juden und international anerkannten Rechtswissenschaftlers Joseph H. H. Weiler zu verwenden.5 Das alles stellt den Katholizismus vor neue Herausforderungen. Diesen Herausforderungen können wir nur durch die tiefgreifenden Reformen des evangelikalen Katholizismus begegnen: Reformen, die die wesentliche, von Christus gegebene Form der Kirche wieder zur Geltung bringen und gleichzeitig ihren Gläubigen und geweihten Amtsträgern das Rüstzeug an die Hand geben, um eine entzauberte und nicht selten feindselige Welt zu bekehren.
Zusammenfassend betrachtet ruft der evangelikale Katholizismus die Katholiken (und alle, die sich für die katholische Kirche interessieren) dazu auf, die von links und von rechts vorgebrachten, oberflächlichen Argumente der vergangenen Jahrzehnte, bei denen es in erster Linie um die Macht der Kirche ging, hinter sich zu lassen und sich eingehender mit dem missionarischen Herzen der Kirche zu befassen – und mit der Frage, wie dieses Herz sich im 21. Jahrhundert und im dritten Jahrtausend ausdrücken könnte. Der evangelikale Katholizismus handelt von der Zukunft. Sein Wesen zu erfassen setzt jedoch auch einen veränderten Blick auf die jüngere katholische Vergangenheit voraus. Deshalb wollen wir genau dort beginnen.
KAPITEL EINS
Abschlüsse und Anfänge
Einige wenige Jahre nach der Wahl Benedikts XVI. war eine markante Tatsache über seinen Nachfolger bereits bekannt: Wer auch immer er sein und woher auch immer er stammen mochte – der nächste Papst würde kein Mann sein, der am Zweiten Vatikanischen Konzil teilgenommen hatte.
Anders als der heilige Johannes Paul II., der als junger polnischer Bischof eine bedeutende Rolle bei der Vorbereitung mehrerer Konzilsdokumente gespielt hatte, und anders als Benedikt XVI., der als Joseph Ratzinger ein wichtiger theologischer Berater auf dem II. Vaticanum gewesen war, wird der nächste Bischof von Rom das wichtigste katholische Konzil seit dem Tridentinum nicht selbst miterlebt haben. Und sollte Benedikt XVI. ein solch langes und erfülltes Leben vergönnt sein wie dem Begründer des modernen Papsttums – Leo XIII., der 1903 im Alter von 93 Jahren starb –, dann wäre es sogar möglich, dass sein Nachfolger in der Zeit, als das Konzil tagte, also 1962 bis 1965, noch nicht einmal geboren war oder vielleicht gerade erst die Grundschule besuchte. Der nächste Papst wird sein gesamtes kirchliches Leben in den Turbulenzen der nachkonziliaren katholischen Kirche verbracht haben. Anders als seine beiden unmittelbaren Vorgänger wird der 265. Nachfolger des heiligen Petrus an der Erfahrung des II. Vaticanums, die Johannes Paul II. und Benedikt XVI. so maßgeblich geprägt hat, nicht teilgehabt haben.
Als Benedikt XVI. 2005 im Alter von 78 Jahren gewählt wurde, sagten manche, er werde ein »Übergangspapst« sein. Exakt dasselbe hatte man auch 1958 bei der Wahl des 58-jährigen Johannes XXIII. erwartet. In beiden Fällen erwies sich die Prognose als wahr – wenn auch nicht unbedingt so, wie sie von ihren Urhebern eigentlich gedacht war. Denn keiner dieser beiden Päpste war nur ein Platzhalter, wie sich die Propheten ihr »Übergangspapsttums« vorgestellt hatten; der »Übergang« spielte sich auf einer ganz anderen Ebene ab.
Mit der Einberufung des Zweiten Vatikanischen Konzils versuchte Johannes XXIII., die kirchlichen Voraussetzungen für ein neues Pfingsten, eine neue und belebende Geisterfahrung zu schaffen, die es der Kirche ermöglichen sollte, mit erneuerter evangelikaler Energie in das dritte Jahrtausend einzutreten und die moderne Welt in einen Dialog über die Zukunft der Menschheit einzubinden. Schlussendlich löste sein Konzil jedoch eine katholische Identitätskrise aus, die das Pontifikat seines