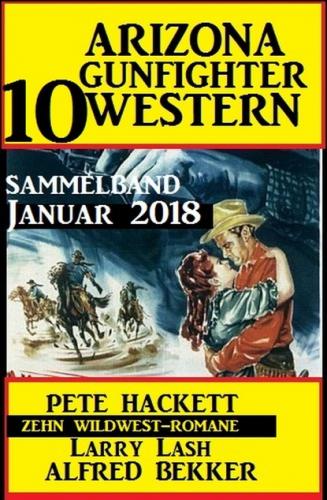Paul lachte breit, aber dieses Lachen blieb ihm plötzlich in der Kehle stecken. Seine Augen wurden ganz starr und blickten zum Muldenrand hin, wo gespenstisch lautlos um das Lager herum sieben Mann wie aus dem Erdboden heraus hervorwuchsen und mit ihren tief angeschlagenen Waffen einen Anblick boten, der einen Mann lähmen und ihm den Herzschlag aussetzen lassen konnte. Diese Leute sagten nicht: „Hebt die Hände zum Himmel“, nein, sie wuchsen aus dem Erdboden heraus, und allein in ihrer Haltung war etwas, was selbst weniger erfahrenen Leuten deutlich gemacht hätte, dass es besser für sie war, sich nicht zu bewegen und eine verdächtige Geste auszuführen. Hartgesichtige Männer in der Kleidung texanischer Cowboys blickten sie über die matt schimmernden Läufe ihrer Waffen an. Sie trugen Chaps, wie sie im texanischen Dornenland üblich waren und besonders in der Nähe von Pelcon getragen wurden. Das und noch einiges mehr bemerkte Dan auf den ersten Blick, und er war es, der betont ruhig sagte:
„Wenn ihr etwas zu essen haben wollt, ich glaube kaum, dass es für noch sieben Mann reicht, doch was wir haben, wird gern geteilt.“
Das drohende Schweigen der sieben Männer vertiefte sich. Einer von ihnen gab zwei Männern, die seitlich von ihm standen, einen Wink. Die beiden Männer gingen zu den Pferden, prüften sie eindringlich und untersuchten die Satteltaschen. Das gefährliche Schweigen hielt weiterhin an.
„Wäre es nicht an der Zeit, uns zu fragen, was das alles zu bedeuten hat?“, wollte Paul Millard schließlich wissen. „Wir haben nichts zu verbergen und nichts zu verstecken. Wir sind auf dem Ritt nach Texas und führen auch keine Reichtümer mit uns.“
Die beiden Männer, die die Pferde in Augenschein genommen hatten, waren mit ihrer Aufgabe fertig, und einer von ihnen schüttelte den Kopf. Der Anführer der Männer wirkte einen Augenblick als wäre er enttäuscht, doch dann sagte er rau: „Wir werden sehen. Nehmt ihnen die Gurte und Waffen ab!“
„Wozu, Mister?“, fragte Paul Millard ruhig. „Wenn ich mich nicht irre, seid ihr Treibherdencowboys und keine Banditen. Ihr würdet uns harmlose Reiter nur aufhalten.“
„Halt den Mund!“, fuhr ihn der Sprecher an. „Es wird sich herausstellen, ob ihr so harmlos seid. Der Ausrüstung nach seid ihr es nicht, auch euer Gehabe spricht nicht dafür. Macht keine Dummheiten, wir nehmen euch mit. Josuah wird euch unter die Lupe nehmen und uns sagen, ob wir die Richtigen erwischten. Los denn, legt ab und vertraut lieber nicht auf einen Trick. Uns kann man mit keinen Tricks hereinlegen.“
Es sah auch nicht danach aus, ob das bei den sieben Mann möglich war. Es waren Treibherdencowboys, und das allein genügte schon, um einzusehen, dass sie hart arbeitende Männer waren und jeder für sich ein Kämpfer. Es hatte keinen Sinn, sich gegen sie aufzulehnen.
„Es scheint, dass wir Pech haben, Dan“, sagte Lee Millard, als er langsam Gurt mit Holster und Colt abschnallte und vor seine Stiefelspitzen legte. „Das Pech klebt an unseren Stiefelabsätzen und lässt sich scheinbar nicht abschütteln. Ich bin gespannt, was man uns jetzt vorwirft und in die Stiefel schieben will. Ich habe einen verteufelt schlechten Geschmack auf der Zunge.“
Dan und Paul hatten ebenfalls den Gurt abgeschnallt. Die drei mussten sich dann gefallen lassen, dass man sie nach weiteren Waffen abtastete und sie dann aufforderte, sich in die Sättel zu heben, um ihnen dann Hände und Füße zusammenzubinden. Wenig später ritten sie an ihre Pferde gefesselt mit den sieben Cowboys in die Nacht hinein.
Als Dan Flemming jetzt die Gesichter der Männer aus der Nähe sah, erschrak er und konnte nur mühsam sein gleichgültiges Gesicht bewahren. Einige der Männer kannte er von früher, aus der Zeit, da er noch mit seinem Vater hinter Rindern her geritten war. Jeden einzelnen von ihnen hatten sie eindringlich gemustert, doch keiner hatte Dan erkannt. Dan aber kannte sie, er konnte sich erinnern, dass es Cowboys aus der Nähe von Pelcon waren, jener Stadt, an deren Sheriffoffice zuerst sein Steckbrief ausgehängt worden war.
Was würde sein, wenn auch sie ihn erkannten? Von seinen Beobachtungen und Befürchtungen
konnte er seinen Begleitern im Moment allerdings nichts mitteilen. So wie die Situation war, hieß es die Nerven zu behalten. Es gab keinen Zweifel, dass sie von den Cowboys als Verbrecher der schlimmsten Sorte angesehen wurden, dass sie zu stolz und hochmütig waren, um sich mit ihnen in ein Gespräch einzulassen. So war nur das Quietschen des Sattelleders, der Hufschlag der Pferde und ab und zu ein Prusten und Schnauben zu hören. Es kam hinzu, dass man die Gefangenen nicht zusammen reiten ließ. Man hatte sie getrennt, um ihnen eine Verständigungsmöglichkeit zu nehmen. Letzteres zeigte nur zu deutlich, dass die Treibherdencowboys beileibe keine Greenhorns waren. Diese Männer, die gewohnt waren, riesige Rinderherden über Tausende von Meilen über reißende Flüsse hinweg, durch Sandstürme, durch Ödland, über Gebirge hinweg und durch feindliches Land an ihren Bestimmungsort zu bringen, hatten ihre Lektionen bekommen und machten so leicht keinen entscheidenden Fehler.
Dan sah Paul Millard vor sich reiten, eingekeilt zwischen zwei Treibherdencowboys, die rechts und links von ihm ritten und ihm so nahe waren, dass ihre Bügel die seinen zu streifen schienen. Sie konnten so jeden seitlichen Ausbruchsversuch verhindern. Dans Begleiter war der Sprecher des Trupps, ein großer und breitschultriger Mann mit schneeweißem Haar, das unter der Stetsonkrempe hervorquoll. Der Mann hatte eine starke Hakennase und einen dünnlippigen Mund. Er ließ Dan nicht einen Moment lang aus den Augen. Hinter Dan ritt Lee, und wenn Dan sich umsah, konnte er Lees gleichmütiges Gesicht sehen. Er schien wie sein Bruder Paul nicht einen Moment lang die Ruhe verloren zu haben.
Dans Sorge wuchs, je stärker der stechende Geruch aufkam, als der Trupp sich dem Treibherdenlager näherte.
|
|
|
7.
Bald war die erste große Herde erreicht, die sich gelagert hatte. Nur vereinzelte Stiere standen mit tief gesenktem Gehörn da und schauten zu den Reitern hin, die am Herdenrand entlang den Weg zum Treibherdencamp nahmen. Die Wagen tauchten in der Nacht auf und zeichneten sich gegen den helleren Nachthimmel ab. Dort, wo die Seilcorrals die Rinderpferde einpferchten, zeigten sich zwei Pferdewächter. Der größte Teil der Mannschaft schien aus dem Camp geritten zu sein.
„Ist Josuah da?“, fragte Dans Begleiter einen der Remudawächter.
„Nein, Vormann“, wurde geantwortet, „Josuah ist noch nicht zurück.“
„Anhalten und absitzen“, ordnete der Vormann an. „Bindet sie von den Pferden.“
Wortlos wurden die Befehle befolgt. Dan, Paul und Lee atmeten erleichtert auf und rieben sich die durch die Fesselung angeschwollenen Handgelenke.
„Sobald die anderen Trupps zurück sind, wird sich herausstellen, ob ihr die Schufte seid, die Benny erschossen und uns die besten Pferde aus der Remuda holten“, sagte der Vormann und deutete auf einen frischen Erdhügel in der Nähe. „Ihr werdet Benny dann bald Gesellschaft leisten.“
„Jetzt wissen wir wenigstens, was wir getan haben sollen“, meldete sich Paul. „Es wäre besser gewesen, wenn Sie uns in unserem Camp in Ruhe gelassen hätten, Vormann. Mit dieser Sache hier haben wir nichts zu tun.“
„Es waren drei Mann und ihr seid zu dritt. Sollten sich keine Beweise für eure Unschuld erbringen lassen, seid ihr erledigt. Josuah hatte mit Benny Herdenwache und