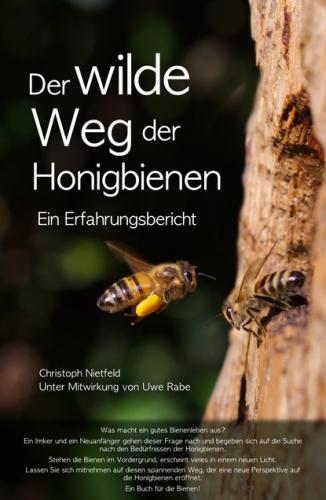Die Varroamilbe ist wahrscheinlich die berühmteste Milbe der Welt. Unter den Imkern ist der Parasit seit Jahrzehnten Gesprächsthema Nummer eins und selbst in den Medien wird immer wieder auch über die Varroamilbe berichtet. Es kann hier und da durchaus der Eindruck entstehen, dass die Imkerei ohne die Varroamilbe problemfrei sei. Was so leider nicht der Fall ist. Es gibt auch noch andere Herausforderungen, wie beispielsweise der Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft, der den Bienen zu schaffen macht. Aber auch die schlechte Ernährungslage der Bienen rückt in letzter Zeit mehr in den Fokus der Öffentlichkeit, glücklicherweise. So wird den Menschen zunehmend bewusst, dass es Monate im Jahr gibt, in denen die Bienen in unserer blütenarmen Landschaft nicht ausreichende Nektarquellen finden, um zu überleben.
Spätestens seit dem Film „More than honey“ wurde dem Interessierten ein weiteres Glied der Problemkette vor Augen geführt: Der Eingriff des Imkers in die natürlichen Abläufe im Bienenvolk. Während im Film die massiven Eingriffe durch eine industriell geführte Imkerei gezeigt wurden – man hätte das Problem nicht plakativer darstellen können –, werden die „normalen“ täglichen Eingriffe der „guten imkerlichen Praxis“, wie auch ich sie jahrelang praktizierte, in ihren Auswirkungen weiterhin unterschätzt. Wir haben es mit einem Sammelsurium an Faktoren zu tun, die auf das Bienenwohl Einfluss nehmen. Es sind komplexe Zusammenhänge, die trotz der Forschungsanstrengungen der vergangenen Jahre noch lange nicht entschlüsselt sind.
Die Varroamilbe wurde Ende der siebziger Jahre aus Asien nach Europa eingeschleppt. Sie ist eine kleine, aber für das bloße Auge sichtbare Milbe, die einen dunkelbraunen, glänzenden, ovalen Panzer hat. Sie vermehrt sich, indem sie ihre Eier in die Zellen ablegt, in der sich Bienenbrut befindet. Die Varroamilbe und ihre Nachkommen ernähren sich von „Bienenblut“, das bei Insekten als Hämolymphe bezeichnet wird. Das schwächt die Bienenbrut, sodass die Bienen nach ihrem Schlupf aus der Zelle etwas kleiner sind als gewöhnlich und eine geringere Lebenserwartung haben. Das scheint aber nicht das größte Problem zu sein. Viel gefährlicher sind die Viren, die von der Milbe auf die Bienenbrut übertragen werden.3 So kommt es zum Beispiel vor, dass Bienen „geboren“ werden, die nicht fliegen können, weil sie verkrüppelte Flügel haben. Hierfür wird der sogenannte Flügeldeformationsvirus oder „Deformed Wing Virus“ (DWV) verantwortlich gemacht. Bisher geht man davon aus, dass vornehmlich fünf verschiedene Viren von der Varroamilbe übertragen werden.4 Da es gegen diese Viren keine Medikamente gibt, hat die Bekämpfung der Milbe als Krankheitsüberträger oberste Priorität, damit möglichst wenige Bienen an den Viren erkranken.
Wie sieht so eine Bekämpfung der Varroamilbe nun in der Praxis aus? In meiner kleinen Hobby-Imkerei habe ich meine Bienen zuletzt einer zweistufigen Behandlung unterzogen, die auch der aktuellen, mehrheitlich anerkannten Vorgehensweise gegen die Varroamilbe entspricht. Dazu habe ich nach der letzten Honigernte, die je nach dem Nahrungsangebot für die Bienen oft Anfang August stattfindet, meine Bienenvölker für rund 10 bis 14 Tage Ameisensäuredämpfen ausgesetzt. Hierfür habe ich zum Beispiel einfach ein mit Ameisensäure getränktes Schwammtuch in das jeweilige Bienenvolk gelegt, sodass die Ameisensäure allmählich verdampfte. Der Säuredampf verteilte sich im Bienenvolk und sollte die Milben auf diese Weise abtöten. Für die Bienen schien der Säuredampf dagegen rein äußerlich unschädlich zu sein.
Zu einem späteren Zeitpunkt, meist im Dezember, habe ich oft noch eine zweite Behandlung durchgeführt, sofern das erforderlich war. Das hing von dem Milbenbefall ab, der sich nach der ersten Behandlung einstellte. Hierfür habe ich jedoch keine Ameisensäure, sondern anfänglich ein synthetisches Mittel namens Perizin eingesetzt und später auf die organische Oxalsäure umgestellt. Beides habe ich in flüssiger Form verabreicht, indem ich es zwischen die Wabengassen direkt auf die Bienen geträufelt habe. Hierzu musste ich den Bienenkasten im Dezember öffnen.
Auch mit Oliver, meinem Baumstammlieferanten, hatte ich mich über die Varroamilbe unterhalten. Er bestätigte mir, dass eine Behandlung gegen die Varroamilbe in der Klotzbeute technisch nicht möglich sei. Doch mit etwas Aufwand könne ich den Baumstamm so gestalten, dass die gängigen Behandlungsmethoden anwendbar würden, ohne dass ich dazu zu weit von der ursprünglichen Idee einer weitestgehend natürlichen Behausung für die Bienen abrücken müsse. Aber wollte ich das überhaupt? Nachdem ich meine Bienen jahrelang nahezu bedenkenlos mit den konventionellen Mitteln gegen die Varroamilbe behandelt hatte, stellte ich mir nun zum ersten Mal die Frage, was die Behandlung für die Bienen überhaupt bedeutete. Konnte nicht auch eine Schwächung der Bienen mit der Behandlung einhergehen?
In der Klotzbeute wollte ich die Bienen möglichst wenig stören, da ich mittlerweile zu der Überzeugung gekommen war, dass jeder Eingriff enormen Stress für die sensiblen Insekten bedeutet. Wenn ich vom Menschen ausgehe, dann führt bekanntlich zu viel Stress zu einer Schwächung des Immunsystems. Vielleicht ließ sich dieses Phänomen auch auf die Bienen übertragen? Könnte ein Bienenvolk, das wenig Stress ausgesetzt ist, ein stärkeres Immunsystem haben? Sollte ich mich also besser ganz gegen eine Milbenbehandlung entscheiden? Es gibt allerdings eine Verordnung, die den Umgang mit Bienenkrankheiten regelt, die Bienenseuchenverordnung (BienSeuchV). Nach dieser besteht eine Behandlungspflicht, wenn ein Volk mit Varroamilben befallen ist oder durch die zuständige Behörde eine Behandlung in einem bestimmten Gebiet festgesetzt wurde.5 Ich konnte also nur auf eine Behandlung verzichten, wenn die Bienen sowieso milbenfrei waren und die zuständige Behörde daher keine Behandlung anordnete.
Von den bienenkundlichen Instituten wird empfohlen, vor einer Behandlung zu prüfen, ob ein Befall vorliegt. Hierfür gibt es verschiedene Methoden. Ich habe zum Beispiel ein Blatt Papier unter die Beute gelegt und nach einigen Tagen die Milben gezählt, die aufgrund des sogenannten natürlichen Totenfalls hinuntergefallen waren. Auf der Grundlage konnte ich mittels Tabellenwerten Rückschlüsse auf den Milbenbefall im Volk ziehen. Das erschien mir gegenüber den Bienen gut vertretbar zu sein. Aber es gibt auch andere Methoden. In dem Leitfaden „Varroa unter Kontrolle“ der Arbeitsgemeinschaft der Institute für Bienenforschung e. V. wird unter anderem die Feststellung des Milbenbefalls mittels Bienenproben beschrieben. Dazu werden etwa 30 Gramm Bienen, das entspricht etwa 300 Bienen, aus dem Volk entnommen. In Schritt 3 der Arbeitsanweisung heißt es wörtlich: „… nach der Abtötung (einfrieren) Gewicht der Bienenprobe ermitteln …“.6 Diese Vorgehensweise erscheint mir grausam und absurd zugleich. Sollte den Bienen nicht ursprünglich geholfen werden, indem ihr Milbenbefall kontrolliert wird?
Wie fühlt sich eine Biene, die gemeinsam mit 299 ihrer Schwestern langsam erfriert? War es etwa gerechtfertigt für den Schutz des Volkes, das Leben von 300 Bienen zu opfern, nur weil diese wenig ins Gewicht fallen, wenn man bedenkt, dass ein Bienenvolk im Schnitt etwa dreißig- bis vierzigtausend Bienen umfasst? Glücklicherweise gibt es ja schonendere Möglichkeiten der Varroakontrolle, wie zum Beispiel die zuvor beschriebene Methode mit dem Blatt Papier oder die Puderzuckermethode, welche ich hier noch erwähnen möchte. Diese ist beispielsweise bei der Bienenhaltung in der Bienenkiste gut geeignet. Bleibt der festgestellte Milbenbefall unterhalb einer für das Bienenvolk tolerierbaren Grenze, kann auf eine Behandlung verzichtet werden und den Bienen bleibt die Prozedur erspart. Aber leider werden Völker oft gar nicht erst kontrolliert, sondern auf Verdacht gegen die Milbe behandelt. Das geschieht scheinbar in vorauseilendem Gehorsam, ganz ohne Anordnung der zuständigen Behörden, aus Angst vor der Milbe. Sogar ganz junge Völker, sogenannte Ableger oder auch Schwärme, werden unmittelbar, nachdem sie gebildet beziehungsweise eingefangen wurden, schon „vorsorglich“ einer Varroabehandlung unterzogen.
Neben den von mir beschriebenen Vorgehensweisen zur Behandlung der Varroamilbe gibt es noch viele weitere Mittel und Methoden, die in der imkerlichen Praxis angewendet werden. Dazu gehört auch, dass teilweise empfohlen wird, die Ameisensäure nach der Ernte im August zweimal einzusetzen, einmal direkt nach der Ernte und ein weiteres Mal nach der Auffütterung kurz vor der „Winterpause“. Darüber