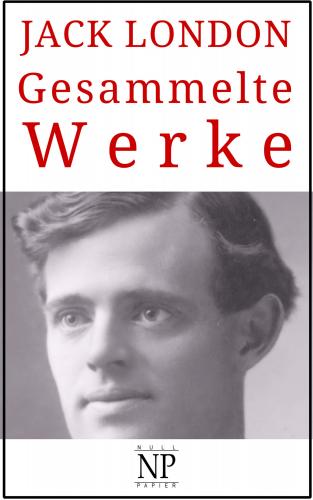Diesmal war es ein mit Band zusammengebundenes Päckchen in Seidenpapier. Sie öffnete es vorsichtig mit dem Ernst und der Umständlichkeit eines Priesters vor dem Altar. Ein kleiner spanischer Gürtel aus roter Seide, mit Fischbein, fast wie ein kleines Korsett, kam zum Vorschein, ein Putz, wie die Frauen der ersten Ansiedler ihn trugen, als sie über die Prärie kamen. Es war eine Handarbeit nach dem alten spanisch-kalifornischen Modell. Selbst das Fischbein war zu Hause aus dem Rohmaterial bereitet, das die Alten von den Walfängern für Häute und Talg eingetauscht hatten. Den schwarzen Spitzenbesatz hatte ihre Mutter selbst verfertigt. Die dreifache Kante aus schwarzem Samtband – jeden Stich hatte ihre Mutter selbst genäht.
Saxon versank in Träumereien und sah auf den Gürtel. Dies war das Konkrete. Dies verstand sie. Dies verehrte sie, wie die Menschen Götter verehren, obwohl die Zeugnisse ihres Aufenthalts auf Erden oft weniger handgreiflich gewesen sind.
Der Gürtel maß zweiundzwanzig Zoll von einem Ende bis zum anderen. Sie wusste das, denn sie hatte ihn oft gemessen. Sie stand auf und legte ihn sich um den Leib. Es war der Teil eines Rituals. Er umschloss sie fast ganz. An einzelnen Stellen ging er ganz zusammen. Wenn sie entkleidet war, passte er ihr, wie er ihrer Mutter gepasst hatte. Nichts griff Saxon so ans Herz wie dieser Überrest aus alten Tagen. Sie hatte die Gestalt ihrer Mutter. Äußerlich glich sie ihrer Mutter. Ihre Geschicklichkeit, die Schnelligkeit, mit der sie ihre Arbeit verrichtete, und über die die anderen so erstaunt waren, hatte sie von ihrer Mutter. Gerade so hatte ihre Mutter ihre Mitwelt in Erstaunen gesetzt – ihre Mutter, das kleine puppenhafte Geschöpf, die Kleinste und Jüngste von der großen Schar der Pioniere, denen sie gleichwohl wie eine Mutter gewesen war. Immer war es ihre Klugheit, zu der sie ihre Zuflucht nahmen, selbst die Brüder und Schwestern, die ein Dutzend Jahre älter waren als sie. Daisy war es, die, mit ihrem kleinen Fuß aufstampfend, den Befehl gegeben hatte, von den flachen Fieberländern Colusas aufzubrechen und in die heilbringenden Berge Venturas zu ziehen; die ihren Vater, den alten wilden Indianerbezwinger, an die Wand gedrängt und den Kampf mit der ganzen Familie aufgenommen hatte, damit Vila einen Mann heiraten durfte, den sie selbst gewählt hatte; die wieder der Familie und der ganzen öffentlichen Moral getrotzt hatte, als sie verlangte, dass Laura sich von ihrem verbrecherisch schwachen Manne scheiden lassen sollte, und die andererseits jedes Mal die Familie zusammengehalten hatte, wenn Missverständnisse und menschliche Schwäche gedroht hatten, sie zu sprengen.
Friedensstifter und Krieger! All die alten Geschichten zogen an Saxons Augen vorbei. Klar in allen Einzelheiten, denn sie hatte sie so oft beschworen, obwohl es Dinge waren, die sie nicht gesehen hatte. Die Einzelheiten waren deshalb auch teilweise Kinder ihrer eigenen Einbildungskraft, denn sie hatte nie einen Zug Ochsen, einen wilden Indianer oder ein Prärieschiff gesehen. Und doch sah sie wie eine Wirklichkeit aus Fleisch und Blut eine lange Karawane der landgierigen Angelsachsen von Osten nach Westen quer über den Kontinent ziehen, eingehüllt in eine sonnenblinkende Wolke vom Staub von zehntausend Hufen. Es war Fleisch von ihrem Fleisch und Blut von ihrem Blut. Sie hatte diese Sagen und wirklichen Ereignisse mit der Muttermilch eingesogen, sie von deren Lippen gehört, die selbst alles mitgemacht hatte. Deutlich sah sie vor sich den langen Wagenzug, die mageren, abgehärteten Männer, die voranschritten, während die Jungen mit Stachelstöcken die brüllenden Ochsen antrieben. Und durch dieses Fantasiegespinst flog wie eine Spindel, die mit Goldfaden das Bild einer Persönlichkeit webte, die Gestalt ihrer unüberwindlichen kleinen Mutter, acht Jahre alt und neun, ehe die große Wanderung zu Ende war, eine Geistermahnerin und Gesetzgeberin, die ihre eigenen Wege gehen wollte – und sowohl der Wille wie der Weg waren stets gut und richtig.
Am allerlebendigsten aber sah Saxon den Kampf bei Little Meadow und Daisy, wie zum Fest gekleidet, in Weiß, mit einer seidenen Schärpe um den Leib, einen Schmuckkamm und Seidenband im Haar und in beiden Händen einen kleinen Wassereimer – in den Sonnenschein auf das blumenübersäte Gras heraustreten aus dem Wagenkreis, wo die Verwundeten in Fieberfantasien schrien und vom rinnenden Quell fabelten, und sie sah sie im Sonnenschein, unangefochten von den Indianern, die das Erstaunen hinderte, ihre Waffen zu gebrauchen, bis zu dem hundert Schritt entfernten Wasserloch und wieder zurück gehen.
Saxon drückte einen leidenschaftlichen Kuss auf den kleinen roten spanischen Gürtel; dann rollte sie ihn schnell zusammen und nahm mit feuchten Augen Abschied von ihrem mystischen Mutterkult und all dem Rätselhaften und Wunderbaren, das Leben hieß.
Als sie im Bett lag, beschwor sie unter den geschlossenen Lidern die wenigen reichen Erinnerungen an die Mutter, die ihre Kindheit barg. Dies war ihre liebste Methode, den Schlaf zu rufen. So hatte sie es ihr ganzes Leben lang gemacht – war in das Todesdunkel des Schlafes mit dem letzten sterbenden, von der Erinnerung an ihre Mutter gefärbten Bewusstsein gesunken. Aber diese Mutter war weder die Daisy von der großen Prärie, noch die von der Daguerreotypie. Die war aus der Zeit, ehe Saxon lebte. Die Daisy, die sie nachts sah, war eine ältere, von Schlaflosigkeit geplagte Mutter, mutig wie jemand, der die Sorge gekannt hat, ein blasses, gebrechliches Geschöpf, sanft und geduldig, das nur lebte durch seine Willenskraft, ohne die es längst den Verstand verloren hätte; das nicht schlafen