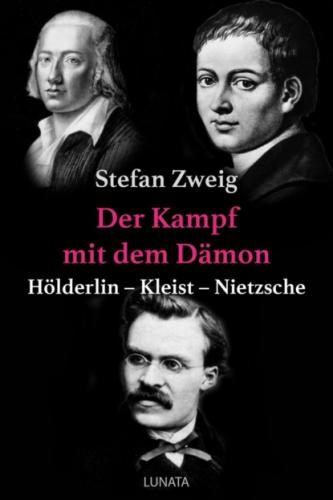Durch diese Liebe zum Dasein zielt alles beim antidämonischen Goethe auf Sicherheit, auf weise Selbsterhaltung. Durch diese Verachtung des realen Daseins drängt alles bei den Dämonischen zu Spiel, zu Gefahr, zu gewaltsamer Selbsterweiterung und endet in Selbstvernichtung. Wie bei Goethe alle Kräfte zentripetal, also vom Äußern zum Mittelpunkt hin sich sammeln, so wirkt bei jenen der Machtdrang zentrifugal, aus dem innern Kreis des Lebens herausdrängend und ihn unvermeidlich zerreißend. Und dies Ausfließen – dies Überfließenwollen ins Gestaltlose, in den Weltraum, sublimiert sich am sichtlichsten in ihrer Neigung zur Musik. Dort vermögen sie ganz uferlos, ganz formlos sich auszuströmen in ihr Element: gerade im Untergang geraten Hölderlin und Nietzsche, ja sogar der harte Kleist in ihre Magie. Verstand löst sich vollkommen in Ekstase, die Sprache in den Rhythmus: immer (auch bei Lenau) umbrandet Musik den Einsturz des dämonischen Geistes. Goethe dagegen hat eine »vorsichtige Haltung« zur Musik: er fürchtet ihre verlockende Kraft, den Willen ins Wesenlose abzuziehen, und dämmt sie in seinen starken Stunden (selbst Beethoven) gewaltsam zurück: nur in der Stunde der Schwachheit, der Krankheit, der Liebe ist er ihr offen. Sein wahres Element aber ist Zeichnung, ist Plastik, alles was feste Formen bietet, was Schranken stellt gegen das Vage, das Gestaltlose, alles was das Zerfließen, Zergehen, Entströmen der Materie hemmt. Lieben jene das, was entbindet, in eine Freiheit führt, ins Chaos des Gefühls zurück, so greift sein wissender Selbstbewahrungstrieb nach allem, was die Stabilität des Individuums fördert, nach Ordnung, Norm, Form und Gesetz.
Mit hundert Gleichnissen könnte man diesen fruchtbaren Gegensatz zwischen dem Herrn und den Dienern des Dämons noch abwandeln: ich wähle nur noch das geometrische als das immer deutlichste. Goethes Lebensformel bildet den Kreis: geschlossene Linie, volle Rundung und Umfassung des Daseins, ewige Rückkehr in sich selbst, gleiche Distanz zum Unendlichen vom unverrückbaren Zentrum, allseitiges Wachstum von innen her. Darum gibt es in seiner Existenz auch keinen eigentlichen Kulminationspunkt, keine Spitze der Produktion – zu allen Zeiten, nach allen Seiten wächst sein Wesen gleich rund und voll dem Unendlichen entgegen. Die Form der Dämonischen dagegen deutet die Parabel: rascher, schwunghafter Aufstieg in einer einzigen Richtung, in der Richtung gegen das Obere, Unendliche empor, steile Kurve und jäher Absturz. Ihr Höhepunkt ist (dichterisch und als Lebensmoment) knapp vor dem Niederbruch: ja, er fließt mit ihm geheimnisvoll zusammen. Darum ist auch der Dämonischen, ist Hölderlins, ist Kleistens, ist Nietzsches Untergang integrierender Bestandteil ihres Schicksals. Erst er vollendet ihr Seelenbildnis, so wie der Niederfall der Parabel die geometrische Figur. Goethes Tod dagegen ist nur ein unmerkbares Partikel im vollendeten Kreise, er gibt dem Lebensbild nichts Wesentliches dazu. Tatsächlich stirbt er auch nicht wie jene einen mystischen, einen heroisch-legendären Tod, sondern einen Bettod, einen Patriarchentod (dem vergebens die Volkslegende durch eine Erfindung: Mehr Licht! etwas Weissagendes, Symbolisches zulegen wollte). Ein solches Leben hat nur ein Ende, weil es in sich erfüllt war: jenes der Dämonischen einen Untergang, ein loderndes Schicksal. Der Tod entgilt ihnen für Armut des Daseins und gibt ihrem Sterben noch mystische Macht: wer das Leben als Tragödie lebt, hat das Sterben eines Helden.
Leidenschaftliche Hingabe bis zur Auflösung ins Elementare, leidenschaftliche Bewahrung im Sinne der Selbstgestaltung – beide Formen des Kampfes mit dem Dämon fordern aber höchsten Heroismus des Herzens, beide schenken sie herrliche Siege im Geist. Die Goethische Lebenserfüllung und der Dämonischen schöpferischer Untergang – beide bewältigen sie, aber jeder Typus in einem anders bildnerischen Sinn, die gleiche, die einzige Aufgabe des geistigen Individuums: an das Dasein unermeßliche Forderungen zu stellen. Wenn ich ihre Charaktere hier widereinander stellte, geschah es nur, um das Zwiefache ihrer Schönheit im Sinnbild zu verdeutlichen, nicht aber, um eine Entscheidung herauszufordern, und am wenigsten, um jene noch umgängliche und durchaus banale klinische Deutung zu fördern, als ob Goethe die Gesundheit darstelle, und jene die Krankheit, Goethe das Normale, und jene das Pathologische. Das Wort ›pathologisch‹ gilt nur im Unproduktiven, in der niedern Welt: denn Krankheit, die Unvergängliches schafft, ist keine Krankheit mehr, sondern eine Form der Übergesundheit, der höchsten Gesundheit. Und wenn das Dämonische auch am äußersten Rande des Lebens steht und sich schon darüber hinaus beugt ins Unbetretbare und Unbetretene, so ist es doch immanente Substanz des Menschlichen und durchaus innen im Kreise der Natur. Denn auch sie selbst, die Natur, sie, die seit Jahrtausenden dem Saatkorn seine Zeit des Wachstums unveränderlich zuzählt und dem Kind im Mutterleib seine Frist, auch sie, das Urbild aller Gesetze, kennt solche dämonische Augenblicke, auch sie hat Ausbrüche und Überschwänge, wo sie – im Gewitter, in den Zyklonen, in den Kataklysmen – ihre Kräfte gefährlich spannt und bis ins Äußerste der Selbstvernichtung treibt. Auch sie unterbricht manchmal – selten freilich, so selten, wie solche dämonische Menschen der Menschheit erscheinen! – ihren geruhigen Gang, aber nur dann, nur aus ihrem Übermaß werden wir erst ihres vollen Maßes gewahr. Nur das Seltene erweitert unsern Sinn, nur am Schauer vor neuer Gewalt wächst unser Gefühl. Immer ist darum das Außerordentliche das Maß aller Größe. Und immer – auch in den verwirrendsten und gefährlichsten Gestaltungen – bleibt das Schöpferische Wert über allen Werten, Sinn über unsern Sinnen.
Salzburg 1925
HÖLDERLIN
Denn schwer erkennt der
Sterbliche die Reinen
Der Tod des Empedokles
Die heilige Schar
... es würde Nacht und kalt
Auf Erden und in Not verzehrte sich
Die Seele, sendeten zuzeiten nicht
Die guten Götter solche Jünglinge,
Der Menschen welkend Leben zu erfrischen.
Der Tod des Empedokles
Das neue, das neunzehnte Jahrhundert liebt seine Jugend nicht. Ein glühendes Geschlecht ist entstanden: feurig und kühn drängt es von allen Windrichtungen zugleich aus den aufgelockerten Schollen Europas der Morgenröte neuer Freiheit entgegen. Die Fanfare der Revolution hat diese Jünglinge erweckt, ein seliger Frühling des Geistes, eine neue Gläubigkeit entbrennt ihnen die Seele. Das Unmögliche scheint plötzlich nah geworden, die Macht und die Herrlichkeit der Erde jedem Verwegenen zur Beute, seit ein Dreiundzwanzigjähriger, seit Camille Desmoulins mit einer einzigen kühnen Geste die Bastille zerbrach, seit der knabenhaft schlanke Advokat aus Arras, Robespierre, Könige und Kaiser zittern läßt, seit der kleine Leutnant aus Korsika, Bonaparte, mit dem Degen die Grenzen Europas nach seinem Gutdünken zieht und die herrlichste Krone der Welt mit Abenteurerhänden faßt. Nun ist ihre Stunde, die Stunde der Jugend gekommen: wie das erste zarte Grün nach dem Frühlingsregen schießt sie plötzlich auf, diese heroische Saat heller, begeisterter Jünglinge. In allen Ländern heben sie sich zugleich empor, den Blick zu den Sternen, und stürmen über die Schwelle des neuen Jahrhunderts, als in ihr eigenstes Reich. Das achtzehnte Jahrhundert, so fühlen sie, hat den Greisen und Weisen gehört, Voltaire und Rousseau, Leibniz und Kant, Haydn und Wieland, den Langsamen und Geduldigen, den Großen und Gelehrten: nun aber gilt Jugend und Kühnheit, Leidenschaft und Ungeduld. Mächtig schwillt sie empor, die aufstürmende Woge: nie sah Europa seit den Tagen der Renaissance einen reineren Aufschwall des Geistes, ein schöneres Geschlecht.
Aber das neue Jahrhundert liebt diese seine kühne Jugend nicht, es hat Furcht vor ihrer Fülle, einen argwöhnischen Schauer vor ihrem Überschwang. Und mit eiserner Sense mäht es unbarmherzig die eigene Frühlingssaat. Zu Hunderttausenden malmt die Mutigsten der Napoleonische Krieg, fünfzehn Jahre lang zerstampft seine mörderische Völkermühle die Edelsten, die Kühnsten, die Freudigsten aller Nationen, und die Erde Frankreichs, Deutschlands, Italiens bis hinüber zu den Schneefeldern Rußlands und den Wüsten Ägyptens ist gedüngt und getränkt von ihrem pochenden Blut. Aber als wollte sie nicht bloß die Jugend allein, die wehrhafte, sondern den Geist der Jugend selbst ertöten, so hält diese selbstmörderische Wut nicht inne bei den Kriegerischen, bei den Soldaten: auch gegen die Träumer und Sänger, die halbe Knaben noch, die Schwelle des Jahrhunderts überschritten