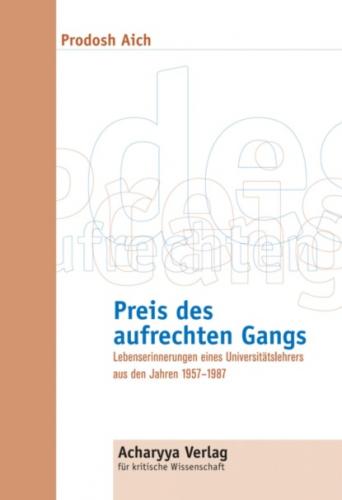Mir wird die SPD–nahe Friedrich–Ebert–Stiftung genannt. Sie ist die erste politische Stiftung überhaupt im Nachkriegsdeutschland und will die demokratische Volkserziehung fördern. Ihr Sitz ist in Bonn in der damaligen Koblenzer Straße, einige Häuser von dem Internationalen Studentenheim in Richtung Regierungsviertel entfernt, also vom Sitz des ISSF. Ich gehe dort hin, hole mir die Bewerbungsunterlagen und bewerbe mich um ein Stipendium zur Förderung des hochbegabten Nachwuchses. Warum auch nicht? In dem Antrag versäume ich nicht, einen eventuellen Universitätswechsel nach Berlin anzukündigen.
Die Arbeit in der Redaktion in Köln läßt mir noch genug Zeit, regelmäßig im Büro des Bundesvorstandes zu sein. Es entwickelt sich so etwas wie eine Freundschaft mit den beiden Vorsitzenden. Rolf Frings, verheiratet, wohnt in Hermülheim bei Köln in einem Haus mit seinen Schwiegereltern. Sein Schwiegervater spielt gern Skat. Auch deshalb bin ich dort willkommen. Günter Krabbe ist allein in Bonn. Er geht nach getaner Arbeit gern in Kino–Spätvorstellungen. Wir gehen immer öfter zusammen.
In der Redaktion in Köln bleibe ich für drei Monate. Eine Verlängerung wäre möglich, aber ein Studium habe ich nicht abgeschrieben. Ich rechne auch mit der „Referentenstelle“ beim Bundesvorstand. Und vage hoffe ich auf ein Stipendium von der Friedrich–Ebert–Stiftung. So habe ich im Augenblick keine konkrete Aufgabe mehr. Und ich besitze wenig Geld. Ich gehe spät ins Bett, stehe spät auf, meist nachmittags zum Frühstück. Immer wenn Fräulein Lehner im Haus ist, habe ich auch nachmittags heißen Tee zum Frühstücksbrötchen. Sonst gibt es halt kalten Tee. Nach dem Frühstück gehe ich zum ISSF. Dann ins Kino. Mit Günter Krabbe. Manchmal auch in zwei Vorstellungen. Kleiner Imbiß danach, dann zu Bett. Zu dieser Zeit gerate ich sogar mit der Mietzahlung in Rückstand. Peinlich. Und perspektivlos. Fräulein Lehner bleibt nach wie vor freundlich. Sie hat mehr Vertrauen in mich, als ich selbst.
Der Bundesvorstand des ISSF muß ein Mitglied für die Wahl im Vorstand des „Young World Federalists“ in Amsterdam benennen. Ich werde benannt und gewählt. Dieser Posten ist zwar ohne eine Aufwandsentschädigung, aber er ermöglicht mir Reisen nach Amsterdam und kostenlose Teilnahmen an außeruniversitären internationalen Seminare. Jeder Reise– und Seminartag bringt mir finanzielle Erleichterung. Die Friedrich–Ebert–Stiftung hat meine Bewerbung bearbeitet und für September zwei Prüfer bestellt: Charlotte Lütkens in Bonn, Sozialwissenschaftlerin und Schriftführerin der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, und Hermann Louis Brill in Wiesbaden, Juraprofessor und Staatssekretär in Hessen.
Im Sommer wird der Bundesvorstand des ISSF von der Unesco, Paris, gefragt, ob er sich zutraue, über die Betreuungssituation der ausländischen Studenten in den deutschen Universitäten einen Bericht zu schreiben. Es stünden dafür 5000,- US-$, also ca. 20000,- DM zur Verfügung. Ein europäischer Vergleich werde angestrebt, um Verbesserungen zur reibungsloseren Integration der ständig wachsenden Zahl der ausländischen Studierenden in Europa zu ermöglichen. Integration als Schlüssel für ein erfolgreiches Studium also. Der Bundesvorstand des ISSF traut sich dieses zu. So werde ich zum Unesco–Referenten des ISSF, noch ohne eine Aufwandsentschädigung.
Beide Prüfer der Friedrich–Ebert–Stiftung, Charlotte Lütkens und Hermann Louis Brill, beurteilen mich so gut, daß ich am 7.November 1958 in die „Hochbegabtenförderung der Stiftung“ aufgenommen werde. Noch ohne ein Stipendium. Die Etatmittel der Stiftung sind für das laufende Haushaltsjahr erschöpft. Die individuelle Betreuung durch Vertrauensdozenten, die Freizeitbegegnungen in der Heimvolkshochschule in Bergneustadt und „Bücherpakete“ gelten ab sofort. Die Stiftung ist großzügig, sie gewährt mir zwei Darlehen mit ordentlichen schriftlichen Verträgen, damit ich über die Runden komme. Zwischenzeitlich habe ich mich an der Universität Köln für das WS 1958/1959 immatrikulieren lassen. Einiges ist inzwischen geschehen.
Ab Herbst bekomme ich eine monatliche Aufwandsentschädigung von 150,- DM. Die beantragten Mittel sind bewilligt. Die 5000,- US-$ aus Paris sind zwar noch nicht da, aber ich beginne unverzüglich mit Erkundungen über Betreuungsmaßnahmen zunächst beim Auslandsamt an der Bonner Universität. Dann in Köln. Die Zeitungen berichten häufig über Diskriminierungen bei der Zimmersuche, in Gastwirtschaften, in Läden, in allen öffentlichen Orten. Das Problembewußtsein beschränkt sich auf Diskriminierung. Und Diskriminierungen seien nicht vorteilhaft für das Ansehen der deutschen Gesellschaft im Ausland. Dies ist auch die Zeit, in der die „Vorurteilsforschung“ ihre Hochkonjunktur erfährt. Vorurteile entständen in der Hauptsache aus Unkenntnis, vor allem bei Personen mit schwachem Ego. Ergo: Die deutsche Bevölkerung sollte mehr Gelegenheit bekommen, die ausländischen Studierenden persönlich kennenzulernen.
Organisierte Begegnungen sind das Rezept. Und Hilfe in allen Lebenslagen: bei der Zimmersuche, beim Erlernen der Sprache, beim Studium „unter die Arme greifen“. Betreuung ist das Zauberwort. Auch studentische Gruppierungen erhalten Mittel für Betreuungsarbeiten. Nur ein Erfolg stellt sich nicht ein. Trotz „Kontaktbörsen“ verschiedener Art. Die Betreuer sehen oft immer die gleichen Gesichter. Die meisten ausländischen Studierenden nehmen die Angebote nicht an. Viele Veranstaltungen fallen aus. Auch im internationalen Studentenheim hat die Bonner ISSF–Gruppe nur bei Tanzveranstaltungen Erfolg. Nach einem Beschluß des Bundesvorstandes besuche ich Betreuungsveranstaltungen der anderen ISSF–Gruppen in der Republik, um diese miteinander vergleichen zu können.
Also schreibe ich sämtliche ISSF–Gruppen an und bitte sie um die Übermittlung der Termine von Veranstaltungen. Die Reaktion ist prompt. Ich reise ohne vorherige Terminvereinbarung. Es ist überall das gleiche trostlose Bild. „Kontaktbörsen“ funktionieren nicht. Die Stammgäste sind relativ gut integriert. Die anderen, die die große Mehrheit bilden, lassen sich nicht anlocken. Wie soll man an sie herankommen?
Ich beginne systematisch Studien über soziale Vorurteile und über gesellschaftliche Benachteiligung zu lesen. Diese sozialpsychologischen, soziologischen und sozialphilosophischen Studien finde ich aufschlußreich. Die Schwägerin von Rolf Frings erzählt mir – ich spiele wiedermal Skat in Hermülheim mit ihrem Vater und ihrem Schwager – von interessanten soziologischen Vorlesungen. Als Nachfolger des eher philosophisch orientierten Leopold von Wiese war der mehr wirtschaftlich und ethnologisch orientierte René König Mitte der fünfziger Jahre zum Lehrstuhl für Soziologie berufen worden. Seine Vorlesungen sollen wegen seiner hervorragenden Rhetorik, seiner breiten Kenntnis über gesellschaftliche Entwicklung und deren Zusammenhänge sehr beliebt gewesen sein. Sie habe einige dieser Vorlesungen gehört, obwohl Soziologie nicht ihr Fach gewesen ist. Sie ist promovierte Volkswirtin der Kölner Universität und arbeitet in der volkswirtschaftlichen Abteilung der Deutschen Bank in Düsseldorf und wohnt in der Woche auch dort.
Also habe ich mich nach der Unterbrechung eines Semesters in Köln wieder immatrikulieren lassen. Aber nicht in der WiSo–, sondern in der philosophischen Fakultät. Soziologie war in den beiden Fakultäten eingebunden. Es ist ja auch für mich nur ein Risiko von 30,- DM als lmmatrikulationsgebühr. Eigentlich gar kein Risiko, weil diese Gebühr die studentische Krankenversorgung sicherstellt. Fräulein Lehner hat die Miete nicht erhöht. Und monatlich 150,- DM war damals nicht wenig Geld. Und dann die vielen Lebenshaltungskosten senkenden „Dienstreisen“ und Seminare.
Vom ersten Tag des Semesterbeginns in Köln macht mir das Studieren zum ersten Mal Spaß. Ich habe eine konkrete Aufgabe im ISSF: Vorschläge zur Verbesserung der Betreuungssituation der ausländischen Studierenden. Eigentlich eine soziologische und ethnologische Fragestellung, wie ich erkenne. Also besuche ich fleißig die Methodenseminare der Fächer Ethnologie, Soziologie, Philosophie und Geschichte. Und noch zwei Hauptseminare: „Geschichte der ethnologischen Theorienbildung“, „Die Angestellten in Betrieb und Gesellschaft“ und die Hauptvorlesung von René König: „Ursprung und Entwicklung von Familie, Wirtschaft, Recht und Staat“.
Jeder Tag an der Kölner Universität läßt mich wachsen. Die 5000,- US-$ von der Unesco, Paris, sind angekommen, aber noch nicht angebrochen. Das Geld ausgeben nur für Beobachtung von „Kontaktbörsen“ an verschiedenen Universitäten? Warum nicht eine Studie zur Überwindung von Vorurteilen? Ich will mir Zeit nehmen für eine solche Entscheidung, und der Bundesvorstand ist damit einverstanden.