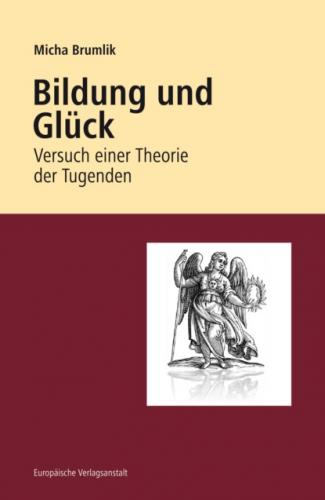„Gleichwohl mutet die Tagesschau jeder Verkäuferin aus dem Supermarkt zu, zwischen Inguschen und Tschetschenen, Georgiern und Abchasen zu unterscheiden. Berg-Karabach steht seit Jahren auf der Tagesordnung, und wir sind gezwungen, uns an Hand von verstümmelten Leichen ein Bild von dieser Gegend zu machen. Wir sollen uns die Namen von Gangstern merken, die wir kaum richtig aussprechen können, und uns um islamische Sekten, afrikanische Milizen und kambodschanische Fraktionen kümmern, deren Beweggründe uns unverständlich sind und bleiben. Wer dazu nicht fähig ist, gilt als hartherziger Ignorant und als egoistischer Wohlstandsbürger, dem es gleichgültig ist, wenn andere leiden.“25
Der Dichter empfiehlt in dieser Lage ein Abrüsten der moralischen Ansprüche und eine Bescheidung auf das Eigene – und sei es nur, um wenigstens den Frieden im eigenen Land zu wahren und nicht auch hier jenen Zuständen Vorschub zu leisten. Führten doch moralische Forderungen, die in keinem Verhältnis zu den Handlungsmöglichkeiten stünden, am Ende nur dazu, daß die Geforderten gänzlich streiken und jede Verantwortung leugnen. Diese Haltung bringt Enzensberger zu einer scharfen Kritik an jeder universalistischen Ethik und der Forderung, sich von allen Allmachtphantasien zu verabschieden und sich um die eigenen Angelegenheiten zu kümmern: „Wer von der Endlichkeit und Relativität unserer Handlungsmöglichkeiten spricht, sieht sich sofort als Relativist an den Pranger gestellt. Doch insgeheim weiß jeder, daß er sich zuallererst um seine Kinder, seine Nachbarn, seine unmittelbare Umgebung kümmern muß. Selbst das Christentum hat immer vom Nächsten und nicht vom Fernsten gesprochen.“26
An diesem Vorschlag zeigt sich, daß aus der möglichen Diagnose, die guten Zeiten seien vorbei, in der Sache durchaus gegensätzliche Konsequenzen gezogen werden können: einerseits die kluge Beschränkung auf die eigenen Angelegenheiten, andererseits der bewußte Wille, die Belange aller Menschen zum vordringlichen Gegenstand des eigenen Denkens und – womöglich – eigenen Handelns zu machen. Einem tiefenpsychologisch informierten Denken wird dieser Vorschlag unmittelbar einleuchten. Moralische Forderungen, so meinen wir seit Nietzsche und Freud zu wissen, beeinträchtigen nicht nur die vitalen Bedürfnisse von Menschen und dienen nicht nur der projektiven Abwehr eigener Aggressionen, sondern leisten zudem einem grundsätzlich falschen Selbstverständnis, einer systematischen Selbsttäuschung und damit einem unwahrhaftigen Leben Vorschub. Wer in erster Linie moralischen Forderungen folgt, tue dies in aller Regel, um vom eigenen Leben und dessen Problemen abzulenken. Wer sich aber – wie die Debatte um die „hilflosen Helfer“27 gezeigt hat – über sich selbst täuscht, ist schließlich nicht in der Lage, anderen effektiv und angemessen beizustehen. Somit scheint an Enzensbergers Vorschlag kein Weg vorbeizuführen: Das Ende der Leichtigkeit, das bewußte und klare Wahrnehmen des Elends nicht nur dieser Gesellschaft, sondern der ganzen Welt führt zu einer neuen Bescheidenheit, aber auch zu einem eingeschränkten Engagement.
So bietet sich ein verwirrendes Bild: Während hier Philosophen und Politiker angesichts von Kriminalität, Drogensucht, Hedonismus, Liberalismus und Individualismus für einen neuen Wertehorizont, für Tugenden und strikte Regeln optieren, wird dort für ein Ent- und Abspannen der eigenen Ansprüche plädiert. So unvereinbar diese beiden Alternativen auf den ersten Blick erscheinen, so sehr gelten sie doch demselben Gegner: nämlich dem, was in ihrer Sicht als universalistische, abstrakte Ethik gilt. Eine moralische Haltung, die einerseits darauf verzichtet, Menschen bestimmte und konkrete Verhaltensvorschriften zu machen, sie Mores zu lehren, die aber andererseits strikt darauf beharrt, daß Fragen nach Recht und Gerechtigkeit nicht wesentlich durch Hinweise auf Nähe oder Ferne, Freundschaft oder Verwandtschaft der jeweils betroffenen Menschen oder auf der eigenen Gemeinschaft Zuträgliches oder Förderliches zu lösen sind, wird in der Regel „universalistisch“ genannt und – je nach Standpunkt des Kritikers – als überfordernd oder unverbindlich bezeichnet.
Für psychosoziale Berufe, für Pädagogen, Therapeuten und Berater stellt sich damit die Frage, welche Maßstäbe und Ziele sie sowohl an die eigene Arbeit als auch an das Tun all derer anlegen wollen, die ihnen im Erziehungsprozeß überantwortet sind oder die sich ihnen als Leidende oder Ratsuchende anvertraut haben. Damit ist zugleich die Frage nach der beruflichen Verantwortung von Pädagogen, Therapeuten und Beratern als die Frage gestellt, wofür Kinder, Heranwachsende oder Klienten im idealen Fall später Verantwortung übernehmen, d. h. welche Art der Moral sie erwerben sollen.28 Daran zeigt sich, daß mindestens Psychotherapie und professionelle Erziehung insoweit stets am Ende der Leichtigkeit operieren, als beide niemals umhin können, Verantwortung ein- und auszuüben – unabhängig davon, ob sie das beabsichtigen oder nicht. Strittig ist allenfalls, welche Reichweite diese Verantwortung jeweils haben soll. Daß es darauf im Einzelfall keine abstrakte Antwort geben kann, leuchtet ebensosehr ein wie die Vermutung, daß die Reichweite der Verantwortung im Prinzip zu ermessen sein sollte.
Für das Erziehungssystem wird daher vorgeschlagen, sich zur Heilung gesellschaftlicher Übel und Gebresten wieder auf die kleinsten leicht zugänglichen gesellschaftlichen Einheiten zu beziehen, auf Familie und Schule. Wenn überhaupt, so scheint es, konkrete Verantwortung für diese Gesellschaft eingeübt werden kann, dann dort, wo Kinder und Jugendliche zu verantwortungsvollen Bürgerinnen und Bürgern gebildet werden. Nirgendwo wird das Ende der Leichtigkeit so massiv eingeklagt wie im Erziehungsbereich, nirgendwo anders scheinen die libertären Umgangs- und Lebensformen, die ein Ergebnis der Kulturrevolution der späten sechziger Jahre waren, so verhängnisvoll gewirkt zu haben, scheint der Katzenjammer so groß zu sein.29 Die Beunruhigung über jugendliche Neonazis, Drogenabhängige und Vandalismus in Schulen vermengt sich so mit dem Gefühl von Orientierungslosigkeit, an der die Sozialwissenschaften nicht unschuldig seien. Das Einklagen einer allgemeinen erzieherischen Verunsicherung aufgrund des Reflexionsschubs, den das Eindringen erziehungswissenschaftlicher Einsichten in die Lebenswelt von Eltern, Kindern und Schülern verursacht habe, fordert zu der Beschwörung heraus, daß künftig wieder erzogen werden müsse. Darüber hinaus bedienen sich die neuen Erziehungsbefürworter der gerne verwendeten rhetorischen Figur, sich selbst in eine imaginäre Mitte zu plazieren und mögliche, einander ergänzende Extreme zu kritisieren: in diesem Fall den permissiven und autoritären Erziehungsstil. Über