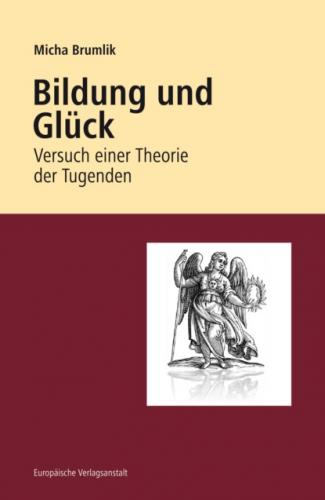Die Theorie der Tugend antwortet auf diese moraltheoretischen Probleme mit einem Rückgang von Kant über Hume zu Aristoteles. Sie konzeptualisiert Moral als Inbegriff der Kriterien und Dispositionen gerechten Handelns als eines wesentlichen Teils – aber eben nur eines Teils – des guten Lebens und weist darauf hin, daß unsere wertenden Haltungen bezüglich der Verteilung und Zumutbarkeit von Rechten, Pflichten und Gütern in vorreflexiven, moralischen Gefühlen wurzeln, die in einem Sachverhalte bewerten und zum Handeln drängen. In einer Theorie des komplexen Naturalismus läßt sich zeigen, daß sowohl Eigen- als auch Nächstenliebe, sowohl das Streben nach kognitiv ausgewiesenen Verteilungsregeln – das wäre Gerechtigkeit – für alle als auch besondere Loyalitäten zu Freunden und Verwandten wesentliche, unaufgebbare und unaustilgbare Dispositionen der Gattung Mensch darstellen. Es gehört zum Lebensvollzug der Angehörigen dieser Gattung, sich je neu und dem Stand gesellschaftlicher Differenzierung entsprechend in unterschiedlichen Sphären auf unterschiedliche Verteilungs- und Zumutbarkeitsregeln einigen zu müssen. Die Motivation dazu darf in einem naturalistischen Programm einfach vorausgesetzt werden. Diese naturalistische Setzung ist denn auch das Hauptmotiv der aktuellen Kritik der neuen Tugendethik.79 Tatsächlich scheint einer Ethik der Tugenden ein nicht zu beseitigendes voluntaristisches Element innezuwohnen. „Wir Europäer von übermorgen“, so projiziert Nietzsche in Jenseits von Gut und Böse eine antike Lehre in die Zukunft, „wir werden vermutlich, wenn wir Tugenden haben sollten, nur solche haben, die sich mit unseren heimlichsten und herzlichsten Hängen, mit unseren heißesten Bedürfnissen am besten vertragen lernten.“80
Wenn Moral die Lehre von den universal gültigen Kriterien richtigen Handelns ist, die Theorie der Tugenden jedoch eine Lehre von wesentlichen, in sich wertvollen Charaktereigenschaften ist, wie soll es dann möglich sein, zu einem Begriff der Moral, der Rechte und der Gerechtigkeit zu kommen? Wiederholt sich hier nicht das Problem des Utilitarismus, wonach ob der gewählten Semantik von Interessen die jeder Moral inhärente Forderung nach Überparteilichkeit gar nicht mehr erreicht werden kann? Lassen sich überhaupt methodische Schritte angeben, auch ohne Inanspruchnahme kategorischer Forderungen, bestimmte Charaktereigenschaften auszuzeichnen und sie als sozial akzeptierte Dispositionen und Verhaltensweisen zu stabilisieren? Dem nächstliegenden Einwand, daß sich aus Charaktereigenschaften keine allgemeingültigen verbindlichen Verhaltensregeln ableiten lassen, könnte man immerhin entgegenhalten, daß die Frage, wie man in einer gegebenen Situation handeln soll, sehr wohl beantwortbar sei: „Eben so, wie eine tugendhafte Person in dieser Situation gehandelt hätte!“81 Verfällt diese Antwort nicht dem Vorwurf des Relativismus und Kontextualismus – daß es nämlich keinen Konsens darüber geben könne, welche Tugenden allgemein erwartbar sind, und mithin das für jede Moraltheorie unabdingbare Universalisierungsproblem unlösbar sei?82Und erhebt sich nicht, wenn dieser Konsens dennoch für möglich gehalten wird, der Einwand, daß dann eben an die Stelle kategorischer Imperative beim Tun oder Unterlassen die unbedingte Forderung nach dem „Besitz“ bestimmter Charaktereigenschaften bzw. das Postulieren einer „richtigen“ Kultur oder Lebensform tritt? Läßt sich zumindest eine allgemeinste richtige Lebensform für die Angehörigen der Gattung Mensch postulieren?83 Und wäre mit alledem gleichwohl nichts weiter erreicht als eine der Sache nach überflüssige Psychologisierung oder Kulturalisierung der Moralsemantik? Michael Slote hat deshalb den Vorschlag unterbreitet, diese Vorwürfe gleichsam positiv zu wenden und den Weg, „Moralität“ als Ausdruck menschlicher Lebensverhältnisse zu verstehen, konsequent zu Ende zu gehen. Das heißt aber, anders als in der modernen Moralphilosophie, zur Bewertung von Handlungen und Handlungsbereitschaften nicht mehr kognitiv-evaluative Prädikate wie „richtig“ oder „falsch“, sondern sozial-evaluative Prädikate wie etwa „rühmlich“ oder „erbärmlich“ – Slote nennt diese Begriffe „aretaisch“ – zu verwenden.84 Damit wäre zumindest ein Zirkelschluß vermieden und die Sphäre intersubjektiver Anerkennung von Personen als der wesentliche Hintergrund dessen, was als moralisch zu gelten hätte, beglaubigt. Dann aber läßt sich immer noch nicht zeigen, daß eine Handlungsweise, die aus irgendeinem Grund in einer Kultur als „rühmlich“ anerkannt wird, deshalb bereits das Prädikat „gerecht“ verdient. Zwar mag in einer Kultur „Gerechtigkeit“ als Tugend hochgeschätzt werden, während eine andere „Demut“ als höchste Tugend ansieht – über die Gründe dieser Wertschätzung ist damit noch nichts gesagt und damit auch noch nichts darüber, ob diese zu Recht bestehen. Tatsächlich zielt eine der intersubjektiven conditio humana entsprechende Ethik der Tugenden auf eine Ethik der Lebensformen hin, wie sie etwa Martha Nussbaum als „aristotelischen Essentialismus“85 postuliert hat. Verallgemeinerbarer Maßstab der Bewertung von Kulturen und Lebensformen wäre dann ihr Potential, menschliches Leben in seinen basalsten Funktionen einschließlich des Strebens nach Glück gedeihen zu lassen.
Dieser Aspekt ist für eine Moraltheorie von besonderer Bedeutung, die sich auf wirkliche Menschen und nicht auf die von Utilitarismus und Kantianismus vorausgesetzten Fiktionen eines homo oeconomicus bzw. eines homo theologicus bezieht. Nachdem in der empirischen Moralforschung das kognitivistische Programm Lawrence Kohlbergs in vielen Hinsichten zusammengebrochen ist – sei es, daß die von ihm behauptete präkonventionelle Stufe bei Kindern kaum nachweisbar war, sei es bezüglich der kaum nachweisbaren motivationalen Kraft fortschreitender kognitiver Einsicht, sei es bezüglich der behaupteten Universalität der Stufen des moralischen Urteils –, treten Fragen nach moralischen Kontexten und Gefühlen wieder stärker in den Vordergrund. Dabei geht es nicht – wie man in der Kohlberg-Gilligan-Kontroverse meinen mochte – um die differentialpsychologische Frage, ob Frauen als biologische Wesen eine andere Moral haben. In dieser Hinsicht hatte Kohlberg recht – die Antwort konnte nur Nein lauten. Wohl aber geht es um die Frage, ob grundsätzlich unterschiedliche Moraltypen – solche, die Gerechtigkeit eher an vermeintlich unparteiliche, abstrakte Prinzipien binden, oder solche, die von wohlbegründeten, konkreten, unterschiedlich gewichteten Loyalitäten ausgehen – systematisch gleichwertig sind. Der systematische Vorrang eines bestimmten Verteilungsprinzips für alle Lebensbereiche – das hat nicht nur Michael Walzer86 gezeigt – läßt sich jedenfalls nicht begründen. „Wer Gleichgültigkeit und Achtlosigkeit ablehnt, muß“, so Onora O’Neill, „anspruchsvollen Maßstäben gerecht werden; doch was diese Maßstäbe fordern, ist unweigerlich variabel und selektiv.“87
Was gerecht ist, erfährt in den Lebensbereichen von Politik und Öffentlichkeit eben eine ganz andere Bedeutung als in den von der systematischen – meist von Männern betriebenen – Philosophie ausgesparten Welten von Familie, Freundschaft und Liebe. Erst eine Theorie der Tugenden kann darüber Aufschluß geben, welche Formen von Wohlwollen, Mitleid, Einsicht und Pflichtbewußtsein, welches Amalgam moralischer Gefühle und Einsichten das „moralische Selbst“ von Menschen in ihrer ganzen Komplexität ausmachen.
Eine Theorie der Tugend vermag also speziell in der Pädagogik und der ihr entsprechenden Theorie moralischer Bildung im Unterschied zu den Reduktionismen von Kantianismus und Utilitarismus
•das Phänomen der Moral unverkürzt unter Einschluß der motivationalen Frage aufzunehmen;
•die Frage nach der sozialen Einbettung von Handlungsbereitschaften in auf wechselseitiger Anerkennung beruhenden Gemeinschaften zu thematisieren;
•die bisher übersehene Frage nach dem Eigeninteresse der Individuen und somit nach einer Bedingung ihres Glücks konstitutiv zu integrieren;
•der Komplexität und Disparatheit moralischen Fühlens und Denkens von Personen in der Spannung unterschiedlicher Sphären, aber eines von ihnen zu führenden Lebens, gerecht zu werden;
•umfassender und angemessener als bisher die Kooperation mit einer empirisch fortgeschrittenen, psychoanalytisch oder kognitivistisch verfahrenden Moralpsychologie aufzunehmen und damit den immer wieder eingeforderten Abschied von der Metaphysik abzuschließen.
Letzten Endes verbirgt sich hinter einer Theorie der Tugenden mit ihrer Betonung des Glücksanspruchs der