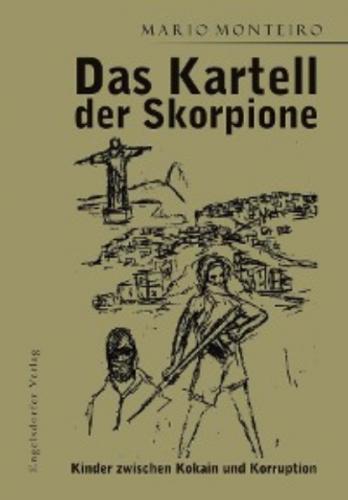Im Instituto Médico Legal könnten die Doktorchen dann zusehen, wie sie das Puzzle aus zusammengehauenen Knochen und einem halben Dutzend verkohlter Muskelfetzen zusammenkriegten.
Der Polizist steckte das Handy in den Gürtel. Der Tag fing richtig bombig an. Auch auf dem ersten TV-Streifen sah man so viel wie nichts. Und wen sie sich heute Morgen im Rush durch den Tunnel vorgeknüpft hatten, das käme sowieso erst raus, nachdem das Fahrgestell identifiziert sein wird oder das, was davon noch übrig war. Kopfschüttelnd stieg der Beamte in seinen Jeep. Viel werden die da nicht mehr finden.
Der alte Mann schaltete das Fernsehgerät aus und tappte zufrieden an den Tisch zurück, um sein Frühstück zu beenden. Seit langem hatte er nicht mehr so gut geschlafen. Die grausigen Hirngespinste, die ihn seit Wochen verfolgten, waren unversehens ausgeblieben und das hatte er eigentlich gar nicht mehr zu hoffen gewagt. Dann hing es also doch mit den neuen Tabletten zusammen, die ihm sein Hausarzt verschrieben hatte. Selbst der kleine Moisés stellte sofort fest, dass sich die Stimmung seines Herrn ganz wesentlich gebessert haben musste. Das Negerchen, das seinen Dienst gewöhnlich in der Küche zu versehen hatte, stand jeden Morgen an einer auf den Zentimeter festgelegten Stelle, etwas abseits von dem tadellos gedeckten Tisch, an dem sich der Anwalt damit beschäftigte, den Rest der Cornflakes auszulöffeln.
Nicht eine Sekunde durfte der Kleine verlieren, wenn es dem Mann am Tisch einfallen sollte, noch etwas zu wollen. Nur nicht schlafen! Mammy trichterte es ihm jeden Morgen von neuem ein. Sonst wird er die Stelle bei Dr. Cariaga am Ende noch verlieren. Und so etwas Gutes würde er heutzutage nirgends mehr bekommen.
Trotzdem war der Kleine nicht so richtig bei der Sache. Viel zu unaufmerksam war er. Ein Glück, dass der Küchenchef gerade nicht in der Gegend war. Seinen Blick starr auf die blank gescheuerten Terrassenplatten geheftet, zählte Moisés heimlich die Tage ab, bis ihm der dicke Frederico das Wochengeld auf den Küchentisch legen würde. Freilich nicht ohne ihm jedes Mal etwas für diese oder jene Kleinigkeit abzuzwacken.
Endlich riskierte der Bub einen scheuen Blick hinüber auf den Tisch und zwar lediglich, um sich zu vergewissern, ob er immer noch mit der guten Laune des Doktors rechnen dürfe.
Zur Beruhigung des Kleinen zeigten sich indessen die unter dem Hauspersonal so gefürchteten Fältchen neben den Mundwinkeln des alten Mannes heute Morgen nicht. Ganz im Gegenteil. Schon zum zweiten Mal strich Dr. Cariaga über sein peinlich gepflegtes Lippenbärtchen, und das war von jeher ein untrügliches Zeichen für seine Zufriedenheit.
Doch weshalb der Doktor so lange mit dieser seltsamen Nadel spielte, hatte Moisés nicht begriffen. Was wollte er nur mit dem komischen Ding? Schon wieder hielt er sie gegen das grelle Sonnenlicht. Moisés senkte schnell das Köpfchen, um seine Neugier nicht zu zeigen.
Trotz der teuren, grünlich getönten Lesebrille auf seiner dünnen, in einer kläglichen Spitze auslaufenden Nase war der schmalbrüstige Siebziger, durch eine frühzeitige Rachitis stark beeinträchtigt und im Übrigen auch etwas zu kurz geraten, eine ziemlich unauffällige Erscheinung, dabei bescheiden, wenn man seinen rundum gepanzerten Bentley und das voll abgesicherte Penthouse hoch über der Avenida Atlántica nicht berücksichtigte.
Entschieden willensstark, dabei nicht mehr als ein Dutzendgesicht, gehörte Alberto Cariaga zu jenen Persönlichkeiten, die auf keinem Empfang anzutreffen waren, in keiner Gesellschaftsspalte erwähnt wurden und es auch peinlichst vermieden, vor eine neugierige Kamera zu geraten.
Und dennoch beeinflusste der Anwalt von Copacabana das Leben der Millionenstadt so nachhaltig, wie es nur Staatspräsidenten oder
machthungrigen Pressezaren möglich gewesen wäre.
Weniger mürrisch als in den vergangenen Tagen, wies er Moisés an, die beiden welken Blätter aus dem Schwimmbad zu fischen. Von dort aus, wo Cariaga gerade seinen letzten Bissen verzehrte, hatte man einen unvergleichlichen Blick über den kilometerweit sich aus dehnenden Badestrand bis nach Leblon hinüber und weit hinaus auf die bläulich silberne See. Und dennoch gehörte jenes grandiose Panorama zu den Alltäglichkeiten, die der einsame Bewohner der Fünfmillionen-Dollarbehausung längst nicht mehr wahrgenommen hatte. Denn Wichtigeres hatte ihn Tag für Tag in Anspruch genommen. So war es heute das Nadelöhr, das ihn den ganzen Tag lang beschäftigen sollte.
Das Nadelöhr im Tunnel von Rebouça! Mit einem jähen Ruck, den er sich selbst nicht recht erklären konnte, richtete er sich auf, beugte sich dann entschlossen über den Tisch und stach die Nadel in das damastene Tischtuch. Sicher wäre niemand, der ihn in diesen Minuten hätte beobachten können, das zynische Lächeln um den schmallippigen Mund entgangen, in Wahrheit eine böse Grimasse, nichts als ein kleiner Schlitz, der einen sekundenlangen Blick in seine Seele erlaubte, von der er selbst kaum eine Ahnung hatte.
Oder versuchte er gar, sich vorzustellen, wie das anmaßende Gesicht McGooleys nun aussehen könnte? Schade! Nachdenklich kniff Cariaga beide Augen zu.
Alle, die draußen in Ipanema oder in den teuren Wohnungen von Leblon wohnten, sich von der angenehmen Brise vor der Barra de Tijuca oder in Leme verwöhnen ließen, waren am Ende gezwungen, sich jeden Morgen durch den Tunnel zu quetschen, um eine halbe Stunde später in eisgekühlten Büros vor den Computern zu sitzen. Doch bis dahin hatten sie nichts zu erwarten als kilometerlange Fahrzeugkolonnen. Abbremsen und anfahren, Meter um Meter hinter dem Vordermann herkriechen, warten bis Ampeln umschalteten und froh sein, wenn man wieder durch den Tunnel war. Dabei war die Mausefalle nur eine der unfehlbaren Waffen, die Dr. Cariaga mit einem einzigen Anruf einzusetzen vermochte.
Moisés flitzte an den Tisch. Hoffentlich hatte Senhor Alberto zu guter Letzt nicht doch noch seine Geduld verloren. Wortlos hielt er dem Kleinen die Nadel entgegen. Moisés sauste los, um das unnütze Ding in die Nähstube zurückzubringen.
»E traga me o celular!«, rief Cariaga hinter ihm her.
Aha! Sein Handy wollte er auch gleich haben. Moyses steckte die Nadel in Luizas Nähkörbchen, flitzte an drei hintereinander liegenden Schlafräumen vorbei, durchs Massagebad und dann ins Arbeitszimmer. Dort hatte das zweite Handy zu liegen. Griffbereit, rechts unterhalb der Schreibtischuhr. Ordnung musste sein. Nie durfte man lange danach suchen müssen.
Jetzt geht bestimmt wieder das Gequatsche los, überlegte Moisés, während er mit dem vergoldeten Funktelefon auf die Terrasse zurückhetzte. Nach einem scheuen Blick auf die ausgestreckte Hand des Mannes hielt ihm Moisés das Handy hin und stahl sich davon.
»Alles okay, Doutor Alberto«, bestätigte sein Partner. Cariaga hasste es, Zeit zu verlieren, wenn einmal etwas beschlossen war. Er sah kurz auf, rückte dann die Brille zurecht und blickte auf die Uhr.
»Wirklich«, fragte er. Alles okay, Guimaraes?«
»Alles okay«, bestätigte der Anrufer und atmete durch. Auf die Minute genau hatten die Skorpione zugeschlagen. Nur einen Sprung weit trieben sie sich vor den Tunneleinfahrten herum oder warteten mitten in der Röhre auf das Opfer, hockten hinter unscheinbaren Mäuerchen, unsichtbar im dichten Gestrüpp längs der Zufahrten. Sie mordeten erbarmungslos und schnell. Die Betroffenen sollten nicht leiden müssen, verlangte Cariaga. Sie durften nur keine Chance haben zu entkommen.
Warum die Organisation im Fall McGooley nicht früher zugeschlagen hatte, war im engsten Kreis um Cariaga keinem so recht klar gewesen. Tagelang machte man im Kartell saure Gesichter, besonders wenn Cariaga nicht in der Nähe war. Hatte man dem Amerikaner nicht pünktlich drei Millionen Dollar auf sein Luxemburger Konto überwiesen? Und dann hatte McGooley die Stirn gehabt, den Betrag zurückzuschicken und sich keine Minute länger an die Abmachungen zu halten. Die erste Operation dieser Art war es doch nicht und der Kontaktmann aus Philadelphia hatte sich inzwischen einen Sack voll Dollar verdient. Warum wollte McGooley auf einmal nicht mehr mitmachen?
Das Schiff, um