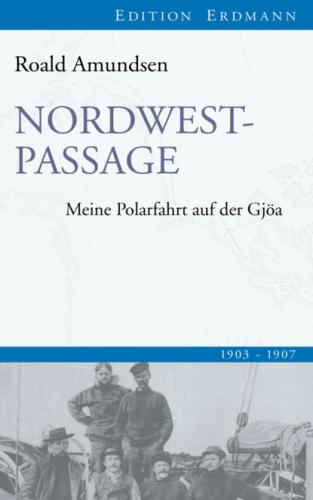Morgens um acht Uhr waren die letzten Kisten sowie sechs Fässer Petroleum nach dem Kai geschafft worden, und ich berechnete, dass wir um neun Uhr ganz fertig sein könnten. Aber ach, es ging anders als nach meiner klugen Berechnung! Plötzlich erhob sich ein Seewind, der uns zwang, Hals über Kopf an Bord zu gehen. Der Anker wurde gelichtet und die Vorsegel wurden gehisst – zu dem Aufziehen des großen Segels war keine Zeit. Die Regenbö jagte scharf daher, aber der Wind sprang glücklicherweise so um, dass er unsere Segelfetzen füllte. Nun ging es rasch vorwärts, und es war die höchste Zeit, denn wir konnten den Abstand vom Land nach Zoll messen. Wir fuhren um die Insel herum und ankerten in Lee auf der anderen Seite. Aber jetzt hatten wir noch die anstrengende Arbeit vor uns, die noch auf dem Kai stehenden elf Kisten und sechs Petroleumfässer auf die entgegengesetzte Seite der Insel zu verbringen. Ich fürchtete mich davor, den Eskimos mit diesem Ansinnen zu kommen; aber sie lachten und scherzten nur und griffen mit frischen Kräften zu. Fertig wurden wir aber doch nicht vor sieben Uhr abends.
Bei unserer Ankunft an der Insel hatten wir die Hunde losgelassen, damit sie uns bei der Arbeit nicht im Wege wären. Sie benützten ihre Zeit sehr gut. Die alten Hunde von der »Fram« und die neuen von Godhavn bekamen Gelegenheit, in einer regelrechten Schlägerei alles, was sie von Streitigkeiten bis dato an Bord aufgespeichert hatten, auszufechten. Viele von den Hunden trugen böse Merkmale der Schlacht an ihrem Leib, als sie jetzt wieder an Bord gebracht wurden. Einer von unseren neuen Hunden war um keinen Preis herbeizulocken, und wir mussten ihn dahinten lassen. Die Eskimos werden ihn später, als er hungrig war, schon eingefangen haben. Mylius Erichsen schenkte mir vier prächtige Hunde, zwei ausgewachsene und zwei erst zwei Monate alte. Diese beiden Hündchen wuchsen zu außerordentlich tüchtigen Hunden heran. Wir nannten sie »Mylius« und »Gjöa«, und der Letztere wurde später unbestritten unser bester Hund.
Um elf Uhr abends erreichten wir die Insel Saunder, wo die literarische Expedition ihren Aufenthaltsort hatte. Und so hart es für uns war, uns nach so kurzem Beisammensein schon wieder zu trennen, so mussten wir ihnen doch hier Lebewohl sagen.
Wir waren nun schwer beladen. Unsere Petroleumbehälter hielten beim Abgang von Dalrymple 19.291 Liter. Das Deck lag auf der Wasserlinie und die Kisten reichten beinahe bis unter den Großbaum. Oben auf den Kisten liefen die Hunde umher und lauerten aufeinander. Es kostete uns große Mühe, die beiden feindlichen Parteien auseinanderzuhalten.
Am siebzehnten August, um halb drei Uhr morgens, setzten wir unsere Reise fort. Es war ein herrlicher Morgen. Ein Gletscher um den anderen dehnte sich im Norden in glänzender Breite aus, bis das Land bei Kap Parry abschloss. Beim Anblick eines Gletschers, den unser kühner Landsmann Eivind Astrup erstiegen hatte, um mit Peary zusammen seine Wanderung über das Inlandeis zu beginnen, wurde es mir sehr schwer, Augen und Gedanken davon abzuwenden. Aber ich musste mich losreißen und meine Aufmerksamkeit auf meine eigenen Angelegenheiten richten. Vor uns erstreckte sich eine Mauer von schweren, neu gebildeten Eisbergen, die wir uns mit Macht vom Leibe halten mussten.
Grönland wurde jetzt kleiner und kleiner, und wir hielten guten Kurs auf Kap Horsburg, den nördlichen Eingang zum Lancaster-Sund. Im Laufe des Tages passierten wir die Carey-Inseln in einer Entfernung von fünfzehn Seemeilen. Glücklicherweise blieb das Wetter still und klar. Wie die Gjöa jetzt belastet war, wäre sie nicht geeignet gewesen, einen Sturm auszuhalten. Es kostete uns ungeheure Mühe, um das Kap Horsburg herumzukommen. Der Wind war ganz abgeflaut; eine hohe Dünung aus Süden, die mit der Strömung aus dem Sund heraus zusammentraf, wühlte höchst unheimliche Wogen auf, und die Gjöa war mit ihrem Motor kein Schnellläufer.
Am zwanzigsten August morgens um halb fünf Uhr waren wir endlich um die Landzunge herum und in dem Lancaster-Sund. Da ich mich entschlossen hatte, nach der Insel Beechey zu fahren, um dort eine Reihe magnetischer Beobachtungen vorzunehmen, hielten wir auf das nördliche Ufer zu.
Mit Ausnahme von wenigen Eisbergen und ganz wenig Schlackeis, das sich vom Land her erstreckte, war das Fahrwasser so gut wie eisfrei. Der Nebel begleitete uns ganz bis Kap Warrender. Hier hob er sich und in dem schönen sichtigen Wetter konnten wir das Land betrachten. Dieses ist sehr verschieden von Grönlands wildem Gebirgscharakter. Am vorherrschendsten ist die Plateauformation, aber sie wird oft plötzlich von Kuppeln unterbrochen; es ist unfruchtbar hier, aber doch nicht ganz ohne Reiz.
Das sichtige Wetter hielt sich nicht lange. Schon am folgenden Morgen waren wir mitten im Nebel. Der Kompass war jetzt etwas unzuverlässig; dies in Verbindung mit dem Nebel muss uns zur Entschuldigung dienen, wenn wir hier irrefuhren. Und wir fuhren wirklich ein paar Mal irre. Aber ich tröstete mich damit, dass es denen, die nach uns kommen, wohl ebenso gehen wird.
Nach ziemlich starkem Kreuzen erreichten wir am zweiundzwanzigsten August abends um neun Uhr die Insel Beechey und gingen an der Erebus Bay vor Anker.
Der Anker war gefallen und das Schiff hatte beigedreht. Die meisten von uns waren zur Ruhe gegangen, um sich einer ununterbrochenen Nachtruhe zu erfreuen.
Es war gegen zehn Uhr und die Dämmerung brach herein.
Ich hatte mich auf eine Kiste gesetzt und schaute mit dem tiefen, feierlichen Gefühl, auf geheiligtem Boden zu sein, nach dem Land hinüber! Dies war John Franklins letzter sicherer Winterhafen gewesen.
Meine Gedanken glitten rückwärts – in längst vergangene Zeiten.
Ich sehe sie vor mir, die stattlich ausgerüstete Franklinflotte, wie sie in den Hafen hineinfuhr und die Anker auswarf.
»Erebus« und »Terror« sind noch in ihrem vollen Glanz! Die englischen Farben flattern auf ihren Mastspitzen und die beiden schönen englischen Schiffe sind voller Leben – Offiziere in glänzenden Uniformen, Bootsleute mit ihren Pfeifen, blau gekleidete Matrosen! Zwei stolze Repräsentanten für die erste seefahrende Nation hier oben in der unbekannten Eiswüste.
Vom Führerschiff wird ein Boot klargemacht. Sir John will an Land gesetzt werden. Die Blaujacken legen sich gut in die Riemen, sie sind stolz, ihren Führer im Boot zu haben. Aus seinem klugen, charaktervollen Gesicht leuchtet Güte; er hat für alle ein freundliches Wort, deshalb lieben ihn die Matrosen. Deshalb haben sie auch unbegrenztes Vertrauen zu dem alten erfahrenen Führer durch die Polargegenden. Jetzt lauschen sie gespannt auf jedes Wort, das zwischen ihm und den beiden Offizieren, in deren Mitte Franklin sitzt, gewechselt wird. Die Unterhaltung dreht sich um die ungünstigen Eisverhältnisse und um die Möglichkeit einer Überwinterung bei Beechey. Es fällt Sir John schwer, sich mit einem solchen Gedanken vertraut zu machen. Aber aus alter Erfahrung weiß er, dass man in diesen Regionen oft gezwungen ist, gerade das zu tun, was man am wenigsten möchte.
Es war diesen kühnen Leuten allerdings gelungen, etliches Neuland zu erforschen, aber nur, um alle ihre Hoffnungen auf die Vollbringung der Nordwestpassage von undurchdringlichen Eismassen vernichtet zu sehen.
Der Winter 1845–46 wurde hier an dieser Stelle zugebracht.
Die dunklen Umrisse einiger Grabkreuze drinnen im Land, die ich von hier aus unterscheiden kann, legen Zeugnis davon ab.
Das Gespenst des Skorbuts zeigte sich hier zum ersten Mal und forderte, wenn auch nicht viele, so doch einige Opfer an Menschenleben.
Als das Eis im Jahr 1846 aufbricht, werden »Erebus« und »Terror« wieder frei. Noch einmal ertönt der frohe Gesang der Matrosen, und die Schiffe fahren zwischen Kap Riley und Beechey hindurch. Noch einmal weht Englands stolze Flagge. Das ist der Abschiedsgruß der Franklin-Expedition. Von da glitt sie hinein in das Dunkel – in den Tod …
Der tüchtigste Forscher Dr. Sir John Rae war der Erste, der Nachricht darüber brachte, in welcher Gegend die Franklin-Expedition verunglückte. Aber die Ehre des ersten sicheren Berichts über das Schicksal der ganzen Expedition gehört dem Admiral Sir Leopold McClintock.
Gar viele Reisebeschreibungen enthalten die Geschichte dieser Tragödie, deshalb will ich sie nicht wiederholen. Franklin und alle seine Leute setzten ihr Leben ein im Kampf um die Nordwestpassage. Wir wollen ihnen ein Denkmal setzen, das dauernder ist