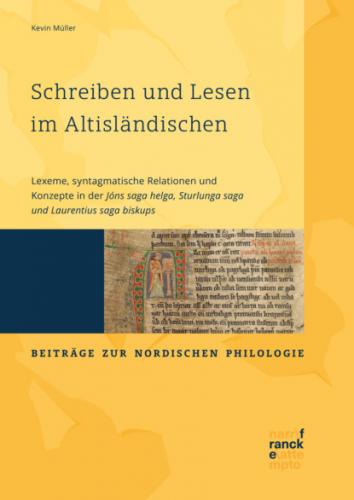Die Jóns saga helga ist die Vita Jón Ǫgmundarsons (1052–1121), der 1106 erster Bischof der nordisländischen Diözese Hólar wurde und im Jahre 1200 auf dem Althing heiliggesprochen wurde. Sie ist eine wichtige Quelle für die Frühzeit des Christentums und der Schriftkultur in Island, auch wenn sie wegen ihres stark legendarisch-hagiographischen Charakters und der stereotypen Elemente als historische Quelle nicht besonders zuverlässig ist (Foote 1993: 345, Kristjánsson 1994: 189, Uecker 2004: 93). Diese Stereotypie stellt aus semantischer Sicht jedoch keine Barriere dar, weil Konzepte stereotyp sind. Ziel dieser Arbeit ist nicht, historische Realitäten, sondern eben die den Lexemen zugrundeliegenden Konzepte zu erforschen. Somit eignet sich die Jóns saga helga als Quelle zumindest für die Zeit ihrer Entstehung und Überlieferung, wenn auch nicht für die Lebenszeit ihrer Hauptperson.
Die Sturlunga saga ist die wichtigste Quelle zur Kenntnis der isländischen Geschichte des 12. und 13. Jahrhunderts (Bragason 2005: 428, Uecker 2004: 112). Die grosse Kompilation setzt sich aus unterschiedlichen Sagas zusammen, in denen nicht die Schriftkultur, sondern die Konflikte der Endzeit des isländischen Freistaates im Zentrum stehen. Trotzdem enthält die Sturlunga saga zahlreiche Belege zum Schreiben und Lesen, im Gegensatz zu den Bischofssagas vor allem in einem Laienmilieu. Die Autoren Snorri Sturluson und Sturla Þórðarson sind zudem Hauptpersonen in diversen Sagas dieser Kompilation. Als Quelle für die Geschichte und die isländische Schriftkultur ist dieser Text also unverzichtbar.
Die Laurentius saga biskups, die Biographie des Bischofs Laurentius Kálfsson von Hólar (1267–1331), ist die jüngste mittelalterliche Bischofssaga und eine wichtige Quelle für den Anfang des 14. Jahrhunderts (Grímsdóttir 1998: LXf., Björnsson 1993: 381, Kristjánsson 1994: 192). Auch sie enthält zahlreiche Belege zum Schreiben und Lesen, aber wieder in einem hauptsächlich klerikalen Milieu wie die Jóns saga helga.
Die drei Texte dieses Korpus decken somit unterschiedliche Zeiträume und Milieus ab, so dass sie ein vielfältiges Bild zur mittelalterlichen Schriftkultur in Island geben. Gegen einige andere Bischofssagas sprechen drei Argumente: Erstens sind einige dieser Sagas handschriftlich spät überliefert. Dies betrifft die Hungrvaka, einen biographischen Abriss der ersten fünf Bischöfe von Skálholt, und die Páls saga biskups, die Biographie des Bischofs Páll Jónsson von Skálholt (1155–1211), die ausschliesslich in Handschriften aus dem 17. Jahrhundert erhalten sind (vgl. Bibire 1993a: 496, Helgason 1938: 27f.). Dies gilt grösstenteils auch für die Árna saga biskups, der Biographie des Bischofs Árni Þorláksson von Skálholt (1237–1298), von der nur zwei spätmittelalterliche Fragmente erhalten sind: das Fragment AM 220 VI fol. mit zwei Blättern und die Reykjarfjarðarbók (AM 122b fol.) aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts mit drei Blättern, in der auch die zweite Redaktion der Sturlunga saga enthalten ist (s.u. Kap. I.3.3.). Der grösste Teil der Árna saga biskups ist sonst nur in frühneuzeitlichen Abschriften erhalten (vgl. Hauksson 1972: v, vii, xxxf.). Das Belegmaterial ist zwar sehr umfangreich, aber sehr einseitig, da es hauptsächlich im Kontext des sehr regen Briefverkehrs der Saga steht.
Zweitens ist das Belegmaterial einiger anderer Sagas vergleichsweise dünn. Dies betrifft neben der oben erwähnten Páls saga biskups (Helgason 1978: 407–438) auch die Hungrvaka (vgl. Helgason 1938: 72–115), was vor allem durch die Kürze dieser Texte erklärt werden kann. Dieser Nachteil betrifft aber auch die längere Þorláks saga helga, die Vita des heiliggesprochenen Bischofs Þorlákr Þórhallsson von Skálholt (1133–1193), die in einem lateinischen Fragment und drei altisländischen Versionen überliefert ist. Sie gilt als zuverlässige Quelle mit wertvollen Hinweisen auf Alltagsleben und Alltagswelt (vgl. Bibire 1993b: 671, Kristjánsson 1994: 187f., Uecker 2004: 94). Eine Durchsicht der drei Versionen in der Edition von Helgason (1978: 175–373) hat jedoch ergeben, dass alle drei Redaktionen relativ wenig Belege zum Schreiben und Lesen enthalten, die ausserdem in ähnlicher Form in anderen Sagas vorkommen. Wegen dieses wenig ergiebigen Materials kann diese Saga weggelassen werden.
Drittens spielt auch die Zusammensetzung von Kompilationen eine Rolle, d.h. die gleichen Textteile kommen in unterschiedlichen Texten vor. Die vier Versionen der Guðmundar saga biskups, der Biographie des Bischofs Guðmundr Arason von Skálholt (1161–1237), basieren auf einer Kompilation von vier Sagas, der Prestssaga Guðmundar Arasonar, der Hrafns saga Sveinbjarnarsonar, der Íslendinga saga und der Arons saga Hjǫrleifssonar, die alle ausser der Arons saga Hjǫrleifssonar in der Sturlunga saga enthalten sind (vgl. Karlsson 1993: 245f., Kristjánsson 1994: 191). Die vier Versionen bieten somit nicht viel anderes Belegmaterial als die Sturlunga saga.
Für eine anfängliche, manuelle Analyse des altisländischen Wortschatzes des Schreibens und Lesens kann dieses Korpus, bestehend aus der Jóns saga helga, der Sturlunga saga und der Laurentius saga biskups, somit als ausreichend betrachtet werden. In den folgenden drei Kapiteln wird die handschriftliche Überlieferung kurz abgerissen, weil sie für das Alter der Belege entscheidend ist.
3.2. Die Handschriften der Jóns saga helga
Die Jóns saga helga ist wahrscheinlich eine Übersetzung einer lateinischen Vorlage des Mönchs Gunnlaugr Leifsson (gestorben 1218/19), die zwar nicht mehr erhalten ist, aber in einem Verzeichnis von 1429 erwähnt wird (vgl. Foote 2003b: CCXV, CCLXXXIII). Die Saga ist wie eine typische Vita strukturiert. Sie beginnt mit Jóns Jugend, berichtet von seinem Wirken und seiner Begabung als junger Geistlicher, seiner Wahl zum Bischof sowie seinem Wirken als Bischof bis zu seinem Tod, und endet mit zahlreichen Wunderberichten. Die Jóns saga helga ist mehrfach ediert worden (vgl. Foote 2003b: CCCXVIIf.). Diese Arbeit stützt sich auf die einzige kritische Edition von Foote (2003a) mit diplomatischer Transkription und Apparat. Foote (2003b) hat die Saga auch normalisiert mit Kommentar herausgegeben. Die Zitate stützen sich auf die kritische Edition, die kommentierte Edition wird zudem für weitere Informationen konsultiert. Es gibt keine vollständigen Übersetzungen der Saga, sondern lediglich zwei englische der S-Redaktion, in denen die Wunderberichte ausgelassen wurden (vgl. Foote 2003b: CCCXVIIf.).
Von der Jóns saga helga gibt es drei Redaktionen, welche Foote in beiden Editionen mit S, L und H bezeichnet. Die S- und L-Redaktion sind in mittelalterlichen Handschriften überliefert, während die H-Redaktion eine frühneuzeitliche Kompilation aus der S- und L-Redaktion bildet. Wegen der nachmittelalterlichen Überlieferung und der starken Ähnlichkeit mit der S-Redaktion wird sie nicht ins Korpus dieser Arbeit aufgenommen.
Die älteste Redaktion hat die Bezeichnung S als Abkürzung für den südisländischen Bischofssitz Skálholt, zu dem die Redaktion in Bezug steht (vgl. Foote 2003b: CCXV). Sie ist in vier mittelalterlichen Handschriften überliefert. Die älteste Handschrift ist ein aus fünf Blättern bestehendes Fragment mit der Signatur AM 221 fol. (S1), von denen vier Blätter Teile der Jóns saga helga enthalten. In den letzten drei Zeilen auf fol. 4vb beginnt die Augustinus saga. Die Ränder sind abgeschnitten und beschädigt, wovon auch der Text betroffen ist. Die Provenienz der Handschrift ist unbekannt. Sie ist wahrscheinlich vor 1300 entstanden. Es ist nicht sicher, ob die Handschrift von einem Norweger geschrieben