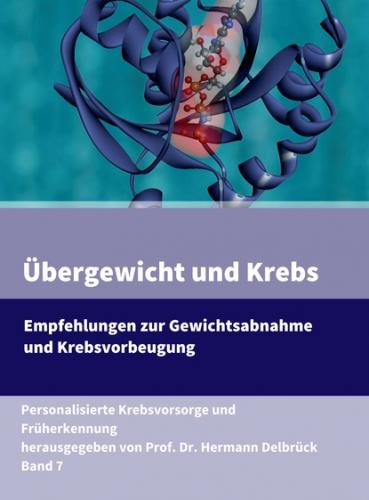Weltweit haben sich die Neuerkrankungen und Todesfälle im Zeitraum von 1990 bis 2017 mehr als verdoppelt. Als Ursachen hierfür nimmt man die höhere Lebenserwartung, den Anstieg des Körpergewichts sowie die geringere körperliche Aktivität an. Ein Zusammenhang mit Übergewicht wird besonders in den wohlhabenden Ländern diskutiert.
Männer mit einem Taillenumfang von mehr als 120 cm – bzw. Frauen mit einem Umfang von mehr als 110 cm – sind besonders bedroht (Kim et al 2009). Die relative Risikoerhöhung (im Vergleich zu Normalgewichtigen) beträgt bei stark Übergewichtigen (BMI > 30 kg/m2) 36 % (Behrens et al 2018). Die Krankheit verläuft bei ihnen auch ungünstiger (Richter 2008, Siegel et al 2010, Aune et al 2011, Arslan et al 2010). Das niedrigste Krebsrisiko besteht bei einem BMI um 21 mit geringem Bauchumfang (WHtR), das größte Risiko hingegen bei einem BMI von > 35 und großer Taillenweite (Arslan et al 2010, Aune et al 2011).
Starkes Übergewicht in der Jugend wirkt sich besonders ungünstig auf die spätere Erkrankungsentwicklung aus (Meydan et al 2018). Als gesichert gilt, dass ein hoher BMI-Wert im mittleren Alter eher ein Erkrankungsrisiko mit sich bringt als ein hoher BMI-Wert bei Senioren (Jacobs et al 2020). Levi et al (2018) wiesen – unter Bezugnahme auf dreißig Jahre währende Verlaufsuntersuchungen bei Wehrpflichtigen – nach, dass weniger das Körpergewicht zum Zeitpunkt der Krebsentdeckung als vielmehr das Gewicht in jungen Jahren ausschlaggebend ist.
Ob Langzeitanwender von Protonenpumpenhemmern ein erhöhtes Risiko haben, wird diskutiert (Brusselaers et al 2019).
Zum möglichen Wirkmechanimus von Übergewicht auf die Krankheitsentstehung gibt es nur Hypothesen. So diskutiert man einen Zusammenhang mit der Insulinresistenz (Halle und Schoenberg 2009). Einige Ernährungswissenschaftler vermuten Zusammenhänge mit einer gestörten Darmflora (Dysbiose), andere mit Bauchfett (Adipozyten) (Berrington et al 2006).
Kommentar und Empfehlungen: Zu unterscheiden sind von der Drüse und von der Papille ausgehende Karzinome (Papillentumore). Letztere befinden sich an der Einmündungsstelle der Gallen- und Bauchspeicheldrüsengänge in den Zwölffingerdarm (Papilla Vateri). Ursachen, Beschwerdesymptomatik, Therapie und Prognose differieren in beiden Fällen. Oftmals ist jedoch eine Gelbsucht das erste Symptom – sowohl bei den Papillentumoren als auch den vom Bauchspeicheldrüsenkopf ausgehenden Malignomen.
Der Verzicht auf Tabak- und Alkoholkonsum, die Reduzierung von Übergewicht und Erhöhung der körperlichen Aktivität sind die wesentlichsten Vorbeugemaßnahmen. Wichtig ist, dass man diese Empfehlungen schon im jugendlichen Erwachsenenalter (< 50 Jahre) beachtet, da ansonsten angeborene Krebsgene aktiviert und eventuelle Krebs-Vorläuferzellen zum Wachstum angeregt werden. Sicher ist, dass dem Bauchspeicheldrüsenkrebs eine sehr viel längere Vorlaufzeit vorausgeht als der relativ aggressive Krankheitsverlauf vermuten lässt.
Die meisten Zysten sind gutartig, einige können sich aber zu einem Karzinom entwickeln. Etwa 4 % der chronischen Pankreasentzündungen gehen in ein Karzinom über.
Kommentar zur Relevanz der Krebsvorsorge-Früherkennung: Für Bauchspeicheldrüsenkrebs gibt es bislang kein gesetzliches Krebs-Früherkennungs-Programm, gleichwohl man den Krebs – gute Untersuchungsbedingungen vorausgesetzt – wahrscheinlich lange vor Beschwerdebeginn erkennen könnte. Ergebnisse aus Untersuchungen mit Bluttests (Liquid biopsy) lassen hoffen, dass zukünftig ein vorzeitigeres Erkennen möglich sein wird (Cohen et al 2017).
Bei einer familiären Disposition sollten ab dem 50. Lebensjahr Vorsorge-Früherkennungsmaßnahmen durchgeführt werden.
Relativ häufig wird bis zu 3 Jahre vor der Krebsdiagnose ein hoher Blutzucker festgestellt. Menschen, die in hohem Alter an Typ-1-Diabetes erkranken, haben ein erhöhtes Erkrankungsrisiko. Bei ihnen sollte man eine Bauchspeicheldrüsenkrebs-Erkrankung ausschließen.
Leberkrebs
Risiken für Leberkrebs, im Vergleich zur Normalbevölkerung (X = wahrscheinlich erhöht, XX = doppelt so hoch, XXX = mehr als doppelt so hoch, XXXX = sehr hohes Risiko)
| • | Leberzirrhose: | XXXX |
| • | Chronische B- und C-Hepatitis: | XXXX |
| • | Nicht alkoholisch bedingte Fetthepatitis (NASH): | XXX |
| • | Starker Alkoholkonsum: | XXX |
| • | Morbus Wilson: | XXX |
| • | Eisenspeicherkrankheit (Hämochromatose): | XXX |
| • | Autoimmunhepatitis: | XXX |
| • | Chronische Erkrankungen der Gallenwege: | XX |
| • | Budd-Chiari-Syndrom: | X |
| • | Aflatoxin-verunreinigte Lebensmittel: | XXX |
| • | Parasiten: | XX |
| • | Übergewicht (Body-Mass-Index > 30): | XXX |
| • | Bewegungsmangel: | XXX |
| • | Tabakabusus: | XX |
| • | Hepatische Porphyrie: | XX |
| • | Typ-2-Diabetes: | XX |
| • | Längerfristige Einnahme von Androgenen: | XX |
| • | Mangel an Alpha-1-Antitrypsin: | X |
| • | Kindliche Tyrosinämie: | X |
| • | Ionisierende Strahlen: | X |
| • | Thorotrast: | XXX |
| • | Vergiftungen mit Vinylchlorid und Arsen: | XXX |
Übergewicht mit begleitender Fettleber (NASH/NAFLD) sowie die chronische Hepatitis B und C mit oder ohne Zirrhose zählen zu den häufigsten Krebsverursachern in den westlichen Ländern. In Osteuropa, Asien und Afrika – wo Leberkrebs wesentlich häufiger vorkommt – dominieren andere Risiken, nämlich die chronische Hepatitis B, Alkohol und Nahrungsmittel-Verunreinigungen, z. B. mit dem Pilzgift Aflatoxin.
NASH/NAFLD ist eine komplexe Erkrankung, für die es nicht nur ein Krankheitsgen gibt. Vielmehr spielen die Interaktionen verschiedener angeborener Gene sowie epigenetische Faktoren bei der Entstehung eine Rolle.
Statistisch gesehen haben übergewichtige Westeuropäer ein mehr als doppelt so hohes Erkrankungsrisiko als ihre normalgewichtigen Landsleute: RR = 1,29 – 1,77 (Welzel et al 2011, Caldwell et al, 2004, Borena et al 2012). In England sind Zusammenhänge besonders auffällig Bei jedem vierten bis fünften Leberkrebspatienten soll dort ein Zusammenhang mit Übergewicht vorliegen, behauptet die Stiftung Cancer Research in Großbritannien. Epidemiologen in Deutschland gehen hingegen nur von einer relativen Erhöhung des Erkrankungsrisikos um 83 % aus. Bei dauerhaftem Übergewicht im jugendlichen Erwachsenenalter ist generell die Gefahr größer (Behrens et 2018).
Übergewicht ist häufig mit einer Fettleber (NASH und NAFLD) verbunden, die gelegentlich in eine Fetthepatitis, eine Zirrhose und schließlich Krebs überzugehen droht. Genetische Faktoren (z. B. PNPLA3), die die Entwicklung einer Fettleber ohne Zirrhose (NASH) beeinflussen, können indirekt auch die Karzinomentwicklung begünstigen. Hartnäckig halten sich Vermutungen, dass der hohe Gehalt industriell hergestellter Fruktose in Softdrinks zur Entstehung des „Risikofaktors Fettleber“ mit beiträgt.
Eine wesentliche Ursache der Krebsförderung sollen Entzündungsfaktoren sein, die im Fettgewebe und in der Fettleber gebildet werden. Die Therapieforschung arbeitete deshalb intensiv an der Entwicklung entzündungshemmender Einflüsse. Blutplättchen scheinen