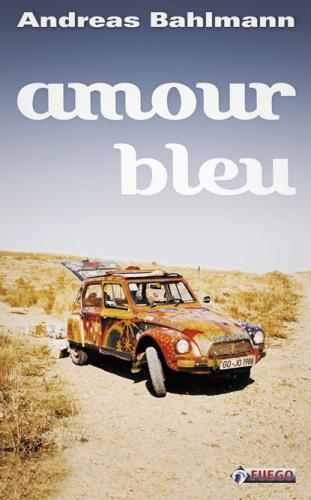Djamal kannte fast jeden im Viertel, und seine immer freundliche Art war beliebt. Sein kleiner Laden war ein steter Treffpunkt lebhaft miteinander plaudernder Anwohner der näheren Umgebung, die dann in kleinen oder manchmal auch größeren Gruppen vor oder in seinem Geschäft zusammen standen und den neuesten Tratsch aus Nachbarschaft und Weltpolitik austauschten. Vom frühen Morgen bis manchmal sogar tief in die Nacht traf man ihn in seinem kleinen Laden an der Straßenecke an, und er war immer freundlich, immer gut gelaunt und offen für einen kleinen Plausch.
Nie beklagte er sich und nie erlebte ich ihn krank.
Seiner Familie galt seine ganze Liebe.
Sein kleines Geschäft war sein ganzer Stolz, für das er hart arbeitete, um seine Familie ernähren zu können. Wenn er neue Waren für seinen Laden besorgte oder andere Dinge zu erledigen hatte, vertrat ihn Azzedine. Die beiden hatten zusammen vier Kinder im Alter von vier bis neun Jahren, alles Mädchen.
Azzedine war eine bildschöne Frau, in deren Gesicht sich allmählich der anstrengende Familien-Alltag einzugraben begonnen hatte. Sie blieb dennoch bildschön. Im Gegensatz zu vielen ihrer weiblichen Landsleute band sie sich kein Kopftuch um, es sei denn, das Wetter war kalt oder es regnete. Sie trug ihre langen, fast tiefblau schimmernden schwarzen Haare meistens offen und mit anmutigem Stolz. Nach Schulschluss alberten ihre vier Töchter fröhlich lachend und spielend im Laden oder auf dem Bürgersteig vor dem Geschäft herum. Azzedine und Djamal ermahnten sie ab und an kopfschüttelnd und liebevoll lächelnd, aber auch zur Mäßigung, wenn es etwas zu wild wurde. Manchmal, wenn sie sich unbeobachtet wähnten, tauschten sie kleine, liebevolle Zärtlichkeiten aus, streichelten einander sanft über die Wangen oder gaben sich auch mal verstohlen ein Küsschen. In der Herkunfts-Kultur ihrer Eltern war so etwas in der Öffentlichkeit verpönt, aber man lebte ja in Frankreich, in Paris, in der Stadt der Liebe.
Ich betrat das kleine Magazin. Djamal hielt mit dem Fegen inne, lehnte seinen Besen an eine der ausgestellten Obst- und Gemüsekisten, folgte mir und trat hinter seinen Verkaufstresen. Nach all den Jahren war selbst in diesem kleinen Schritt noch keine gedankenlose Routine erkennbar. Djamal zelebrierte dieses Einnehmen seines Platzes immer noch mit sichtlich ungebrochenem Genuss, und diese Freude übertrug er in einer unaufdringlichen Art und Weise überall im Verkaufsraum und auf die Kundschaft. Man kaufte einfach gerne bei ihm ein, auch, wenn es bei ihm etwas teurer als im Supermarkt war, der sich ein paar Straßen weiter befand. Aber dafür fand hier das Leben statt, und das konnte man für keinen Preis der Welt kaufen.
»Haben Sie die Musik so laut gehört, Monsieur Gottfried?« fragte mich Djamal. Ich nickte nur bejahend.
»Ich mag dieses Lied, Monsieur Gottfried. Es ist schön, eine schöne Melodie.« Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet! Ich war überrascht, denn mit keiner Silbe erwähnte er die brutal hohe Lautstärke, die mindestens straßenbeschallend gewesen sein musste,... kein Wort der Beschwerde,...nichts dergleichen.
Djamals innere Ruhe und sein Lebensglück waren beneidenswert, weil es ihm trotz der täglichen harten Arbeit eine solche Gelassenheit bescherte. Ich mochte ihn vorher auch schon, aber jetzt erst richtig.
»Monsieur Djamal…, « begann ich zögerlich, »… wir kennen uns doch schon eine ganze Weile…, wollen wir nicht ›Du‹ zu einander sagen?«
Djamal lächelte und reichte mir zur Antwort die Hand: »Gern!« Mit einem herzlichen Händedruck besiegelten wir das »Du«.
Dann deutete ich auf die Zigaretten im Regal hinter ihm, und er gab mir eine kleine Schachtel französischer, filterloser Gauloises und eine Packung Streichhölzer. Er sah mich mit einem leicht verwunderten Gesichtsausdruck an: »Was ist mit dir? Du hast doch noch nie Zigaretten bei mir gekauft. Es geht dir nicht gut, nicht wahr?«
»Leider nein«, entgegnete ich matt.
»Was fehlt dir denn? Bist du etwa krank?«
»Die Liebe, sie fehlt mir…« sagte ich und sah ihn traurig an.
Djamal musterte mich mit einem Blick der Anteilnahme und sagte nur:
»... Isabelle ...?«
»Ja ...,« nickte ich und kämpfte gegen erneut aufsteigende Tränen an.
Ohne weitere Worte zu wechseln legte ich ihm das Geld für die Zigaretten auf den kleinen Tresen. Er öffnete eine Schublade unter dem Tisch, und die Münzen fielen klackernd hinein. Beim Verlassen seines Geschäfts drehte ich mich noch einmal zum Abschied um, und Djamal wünschte mir mit einem aufmunternden Lächeln alles Gute. Ich lächelte zurück.
Draußen folgte ich der Rue Pierre Brossolette, die entlang der Bahngleise verlief. Ich schaute nach oben und sah mein Zimmerfenster. Gleichgültig stellte ich fest, daß drinnen noch das Licht brannte und ein Fensterflügel nur angelehnt war. Ich wohnte im vierten Stock und zu holen gab es bei mir nichts, außerdem war es mir egal.
Ich nahm eine Zigarette aus dem Päckchen, steckte sie an und inhalierte tief. Der harte Rauch brannte in meiner Lunge. Ich unterdrückte reflexartig einen starken Hustenreiz, der alles nur noch verschlimmert hätte. In meinem Mund und Rachen breitete sich ein Geschmack aus, als hätte ich in einen verkokelten Balken gebissen.
Aber ich rauchte tapfer weiter.
Die Sehnsucht zerfraß mir bereits mein Herz, als Zugabe fühlte ich mich jetzt auch noch wie innerlich ausgeräuchert. Alles um mich herum, mein Dasein, geschah wie ferngesteuert. Ich wurde gegangen, vorbei an der kleinen Bäckerei und dem Friseur-Laden, dann wurde ich die Straße überquert, die Eisenbahnbrücke wurde mühsam bezwungen, und der Bahnsteig 2 landete unter meinen Füßen, wo man die Bahn in die City von Paris besteigen konnte.
Der Bahnhof lag in bequemer Sichtweite unter meinem Wohnungsfenster. Die rumpelnden Züge und mich trennten nur vier Stockwerke mit knarrenden Holztreppen und wenige Straßenmeter Fußweg.
Das quietschende Bremsen der einfahrenden, das laute Dröhnen der abfahrenden Vorstadtzüge und RER-Bahnen war tagsüber alle paar Minuten zu hören, abends weniger. Nachts zwischen halb drei und vier Uhr ruhte der Bahnhof der Pariser Vorstadt »La Garenne Colombes«.
Mich störten die Züge nie, ganz im Gegenteil.
Ich mochte diesen Teil meines neuen Lebens, besonders wenn es dunkel war und jedes Geräusch wichtig wurde, weil es sich nicht mehr mit dem Tageslärm vermischte. Die zischend öffnenden Türen, die bedachtsamen oder stolpernden Schritte der aussteigenden Nachtschwärmer, das Klacken der Absätze, das Reißen eines Streichholzes oder Klicken eines Feuerzeuges, welches die eigene Ankunft oder das Weiterfahren des Zuges mit dem Anzünden einer Zigarette quittiert. Die schabenden Schritte auf den Treppenstufen der Eisenbahnbrücke, das Bellen eines Hundes irgendwo in der Ferne oder das Miauen einer Katze im Hinterhof um die Ecke... ich liebte diese geräuschvolle Kulisse des Lebens.
Nach einer gefühlten Ewigkeit näherte sich ratternd die RER-Bahn. Eine Ewigkeit voller schwermütiger Gedanken, die nicht aus dem Herz entweichen wollten, zu sehr zerrte in mir die Liebe nach Isabelle.
Henri hatte also tatsächlich Recht gehabt.
Henri?
Wieso kam ich jetzt bloß auf Henri?
»Ja, ... ich weiß, Henri«, sagte ich im gedanklichen Dialog zu mir selbst:
»Es ist nicht gutgegangen mit uns beiden ...«
Aber ob es wirklich an unseren Sternzeichen lag, wie er damals orakelt hatte?
Ich wußte nur so viel: Mit Isabel war es anders geplant und gehofft gewesen, … wenn ich denn überhaupt einen Plan oder eine Hoffnung gehabt haben sollte ...
Nur spielte das jetzt überhaupt keine Rolle mehr.
Die Metro hielt an, die Türen öffneten sich zischend. Der Sog dieser geöffneten Stahlschlange nahm mich in ihrem Inneren auf und plazierte meine willenlose und weinerliche