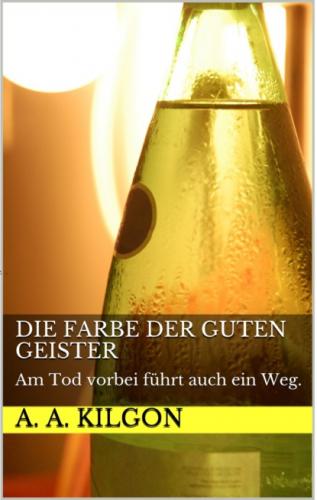Die traurige Realität war unumstößlich die, dass Tilda mit ihren Eltern in dieser Angelegenheit nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen konnte. Sie fand das sehr schlimm. Sie war nicht daran gewöhnt, Differenzen mit ihnen zu haben. Tilda wollte auf keinen Fall im Streit mit ihnen auseinandergehen. Normalerweise hätte sie ihre Reise unter solchen Umständen gar nicht erst angetreten. Es schmerzte sie, dass sie offenbar wirklich in dieser angespannten Situation abreisen musste. Zudem belastete sie der Gedanke, dass ihre Eltern auch Doro deswegen unter Druck setzen würden.
Weinend hatte Tildas Mutter zu ihr bei einem ihrer vielen Anrufe nach der Reiseentscheidung gesagt: „Kind, ich habe das schlimme Gefühl, dass wir uns nicht mehr wiedersehen, wenn du jetzt fliegst!“ Obwohl für Tilda allein der Gedanke daran schon Horror war und sie am liebsten augenblicklich losgeheult hätte wie ein Schlosshund, hatte sie doch mit fester Stimme dagegen gehalten: „Mam, jetzt hör auf damit! Ich fliege zu meiner Schwester und dort überlege ich mir, was ich weiter tun werde. Hier reden doch ohnehin nur alle auf mich ein! Ich kann gar keinen klaren Gedanken mehr fassen. Und ihr seid auch nicht gerade hilfreich für mich, Mam!“ Und nach einer kurzen Pause fügte sie anklagend hinzu: „Denkt ihr denn, ich bin blöd? Mir ist auch klar, dass ich sterben könnte. Und Mam, das will ich nicht! Aber ich brauche einen anderen Plan! Und überhaupt: vielleicht reicht für mich auch schon andere Luft. Ich ersticke hier!“
Etwas unsicher vernahm sie die Stimme ihrer Mutter durch´s Telefon: „Wie meinst du das denn, du brauchst andere Luft? Kind, ich kann dir nicht folgen! Andere Luft heilt doch keinen Krebs!“ Tilda versuchte, ihre Unsicherheit zu überspielen: „Naja, niemand weiß, warum ich diesen Krebs bekommen habe. Vielleicht ist hier irgendein Gift in meiner Umgebung. Was weiß ich denn? Sag du mir doch, woher ich diese Krankheit habe!“ Statt einer Antwort kam nur Schluchzen vom anderen Ende der Leitung. Tilda hatte genug von dieser Depression, die sich wie ein schwarzer Schleier über ihre gesamte Familie gelegt hatte. Schließlich war sie noch nicht tot und wenn sie noch nicht tot war, dann gab es noch Hoffnung.
Aber hin und wieder überkam sie selbst Panik beim Gedanken an den Ausnahmezustand, in dem sie sich befand. Alles in ihrem Leben stand mit einem Mal in Frage. Normalerweise war es so, dass die Eltern vor ihren Kindern starben. Jetzt würde es vielleicht umgekehrt sein. Seit sie an dieser schrecklichen Krankheit litt, die mit dem Fortbestand ihres Lebens unvereinbar war, schienen alle ihr diese Tatsache unablässig deutlich machen zu wollen. So, als ob sie das nicht selbst längst verstanden hätte. Diese Tatsache erzeugte ein unbeschreibliches Vakuum in ihr. Ein Vakuum, das sie immer mehr zusammendrückte und das ihr die Luft zum Atmen nahm. Unter Tränen wiederholte ihre Mutter noch einmal, sie möge doch in Hamburg bleiben, „da man doch schließlich nicht wisse, was kommen würde“.
Tilda spürte, wie ihre Angst sich immer mehr in Aggression verwandelte. Eigenartigerweise war das ein befreiendes Gefühl. Entschlossen stand sie von dem Stuhl im Arbeitszimmer auf, auf dem sie gesessen hatte. „Mam? Ich bin noch nicht tot. Hörst Du? Das kannst du auch Paps sagen. Ich bin noch nicht tot! Und wenn man noch nicht tot ist, dann kann man noch was machen. Mir wird schon irgendwas einfallen. Ich weiß nicht was, aber mir ist bisher immer was eingefallen. Was ich weiß ist, dass ich dringend raus muss aus Hamburg, sonst sterbe ich tatsächlich noch!“ Und mit fester Stimme fügte sie hinzu: „Und ihr beiden seid auch nicht gerade hilfreich für mich! Den Vorwurf müsst ihr euch schon gefallen lassen.“ Sie beendete wütend das Gespräch, indem sie das Telefon auf die Ladestation warf. Neugierig steckte Ludwig den Kopf zur Tür herein. Wahrscheinlich hoffte er insgeheim, Tilda hätte eine Kehrtwende vollzogen. Stattdessen giftete sie ihn an: „Und du? Du kannst auch verschwinden! Ihr seid alle so furchtbar selbstgerecht! Ihr wisst alles besser! Wer ist denn hier eigentlich krank? Nein, du wirst schon nicht sterben, Ludwig! Jetzt guck´ mich nicht so komisch an. Ich kann´s nicht mehr sehen und ich kann´s auch nicht mehr hören. Ich bin froh, wenn ich hier weg bin! Ihr seid doch alle irre! Ihr bringt mich wirklich noch um mit eurem Gerede!“
Voller Wut rauschte sie aus dem Zimmer, nahm eine ihrer Jacken von der Garderobe im Flur und schlug die Tür hinter sich zu, die daraufhin krachend ins Schloss flog. Sie hatte in diesem Moment keine Ahnung, wohin sie gehen sollte. Sie wollte nur weg von Ludwig, raus aus der gemeinsamen Wohnung, raus aus dem Stress. Ziellos lief sie durch die Stadt. Es war inzwischen dunkel geworden. Manche Geschäfte waren noch geöffnet und aus den Schaufenstern floss das Licht golden auf den Bürgersteig. Überall waren Menschen. Es tat Tilda gut, so ganz anonym unter ihnen zu sein. Niemand kannte sie, niemand wusste etwas von ihr. Sie war plötzlich wieder ein ganz normaler Mensch unter vielen anderen ganz normalen Menschen in dieser Stadt. Tilda fühlte sich wie befreit und atmete tief durch. Es war kühl geworden. Die frische Luft füllte ihre Lungen mit Sauerstoff und beruhigte ihre angespannten Nerven. Niemals hätte sie gedacht, wie glücklich sie frische Luft machen konnte.
Sie dachte darüber nach, dass jeder Mensch in seinem Leben immer etwas ganz Besonderes sein wollte. Bis vor kurzem wollte sie das auch. Aber nach allem, was ihr in den letzten Tagen passiert war, mochte sie noch nicht einmal mehr daran denken. Sie wollte einfach nur noch ganz normal sein, vollkommen unauffällig. Sie wollte normale Dinge tun, ein ganz normales Leben haben und vor allem eine ganz normale Gesundheit. War das denn unnormal? War das zu viel verlangt? Gedankenschwer lief sie die hell erleuchtete Straße entlang und unter all den Menschen hatte sie das Gefühl, einzutauchen in diese anonyme Gemeinschaft, von ihr getragen zu werden und einfach nur wie Conny der Korken in der Mitte auf dem reißenden Fluss zu schwimmen. Conny schien alles richtig gemacht zu haben. Conny war fidel, fröhlich, gesund und schlagfertig, obwohl sie so ein furchtbares Schicksal hinter sich hatte. Conny! Umständlich fischte Tilda ihr Handy aus der Jackentasche. Zwanzig Minuten später saßen die beiden Frauen in einem gemütlich erleuchteten Kaffee und tranken gemeinsam ein Glas Wein auf die Zukunft. „Kopf hoch!“ sagte Conny und lächelte ermutigend. „Die anderen in deiner Familie haben doch alle nur Angst. Sie wollen nichts falsch machen. Sie sind wie gelähmt. Versuch´ sie ein bisschen zu verstehen!“ Tilda wollte es ja versuchen. Aber wer verstand sie?
Am darauffolgenden Montag, nachdem sie gerade ihre Flüge gebucht hatte, klingelte das Telefon. Es war die onkologische Ambulanz des Krankenhauses. Dr. Schnitzer selbst, der Onkologe, wollte sie sprechen und scheute offensichtlich keine Mühen, ihr noch einmal zu erklären, dass eine Chemotherapie zwar nur ein Angebot an den Patienten sei, aber dass er ihr unter den gegebenen Umständen dringend dazu raten müsste. Tilda schwieg im ersten Moment irritiert. Sie war verwundert, dass die Fürsorge des Krankenhauses sogar so weit ging, den abtrünnigen Patienten per Telefon zu Hause ins Gewissen zu reden. Gleichzeitig wuchs ihr Misstrauen. Dr. Schnitzer empfahl ihr dringend, noch einmal über ihre Entscheidung nachzudenken? Wieso war ihre Entscheidung denen im Krankenhaus so wichtig? Tilda blieb einsilbig am Telefon. Ihr Blick glitt über die Flugtickets nach Phoenix/Arizona, die ausgedruckt