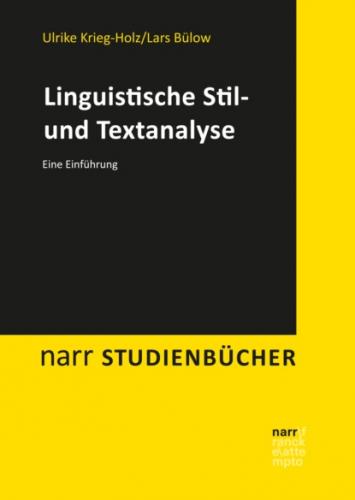VerknüpfungshinweiseKohäsion
AbgrenzungshinweiseBegrenztheit
GliederungshinweiseMusterhaftigkeit
Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass das Verhältnis zwischen Textualitätshinweisen und sprachlichem Ausdruck nicht immer eins zu eins ist, sondern auch in derselben sprachlichen Form verschiedene Textualitätshinweise zusammenfallen können. Ein Beispiel dafür ist die Überschrift dieses Unterkapitels („1.2 Textualitätshinweise“). Sie liefert einerseits einen Hinweis für die Textgliederung, der erkennen lässt, wo eine neue textuelle Einheit beginnt und wie ihr Stellenwert innerhalb des gesamten Textes ist. Andererseits liefert sie einen thematischen Hinweis, durch den verstanden werden soll, worum es in einer textuellen Einheit geht und auf welche Weise das Thema der textuellen Einheit mit dem Textganzen verbunden ist.
Abgrenzungs- und Gliederungshinweise
Die Begrenzbarkeit sprachlicher Erscheinungsformen nach außen und ihre Gliederung nach innen stehen zueinander in enger Beziehung, weshalb sie gemeinsam erläutert werden sollen. Woher wissen wir, wo ein Text anfängt und wo er aufhört? Woher wissen wir, welche Untereinheiten er enthält, was dazugehört und was nicht?
Es gibt Hinweise auf Textgrenzen, die dem Leser signalisieren, wo eine textuelle Einheit beginnt und wo sie aufhört. In seltenen Fällen geben diese Signale Wörter wie Anfang oder Ende, häufiger gibt das Schriftbild mit seinen Seiten- und Zeilenumbrüchen, Leerzeichen, Schrifttypen, Schriftgrößen und vielen anderen Hervorhebungen derartige Zeichen. Relevant kann auch die Materialität der Schrift sein. So unterscheiden sich etwa die Textgrenzen eines Buches von denen eines Briefes: Buchdeckel vs. Briefumschlag.
Bisher fehlen in der germanistischen Forschungs- und Lehrliteratur klare operationale Kriterien für eine Klassifizierung der Abgrenzungs- und Gliederungshinweise von Texten. Prinzipiell scheint es bei der Beschreibung textueller Grenzen und Muster darauf anzukommen, Einheiten nachzuzeichnen, die im Text schon vorgezeichnet sind, und diese dann unter Berücksichtigung ihrer Produktions- und Rezeptionsbedingungen nach der Art ihrer Materialität zu klassifizieren. Zu unterscheiden ist dabei zwischen Abgrenzungs- und Gliederungshinweisen innerhalb und außerhalb des eigentlichen Textes, wobei im Zentrum des linguistischen Interesses naturgemäß die innersprachlichen Hinweise zu Textgrenzen und Textmustern stehen.
Abgrenzungshinweise außerhalb des Textes sind besonders leicht zu identifizieren, wenn sie mit den materialen Grenzen des Zeichenträgers zusammenfallen und somit sinnlich stark wahrnehmbar, d.h. greifbar, spürbar und deutlich sichtbar sind. Dies kann bei einem Bucheinband, der den Anfang und das Ende der Lektüre suggeriert, ebenso der Fall sein wie bei einzelnen, losen bedruckten oder beschriebenen Zetteln oder Blättern wie einem Beipackzettel, bei dem die materiale Einheit einen Hinweis auf die Ganzheit des Aufgedruckten oder -geschriebenen gibt.
Schwerer kann die Abgrenzung von einzelnen Texten innerhalb eines Zeichenträgers sein (z.B. einer Erzählung in einem Sammelband, einer Anzeige in einer Zeitung). Zu den Abgrenzungshinweisen außerhalb des eigentlichen Textes zählen dann bestimmte Merkmale des Layouts/Designs wie beispielsweise der schwarze Trauerrand um eine Todesanzeige. Neben diesen Abgrenzungshinweisen außerhalb des Textes existieren in der Regel innerhalb des Textes zahlreiche Hinweise auf die Ganzheit des Textes. Sie sollen im Folgenden Ganzheitshinweise genannt werden.
Buchcover (Gudula List „Wie Kinder soziale Phantasie entwickeln“)
In Abhängigkeit von der Textsorte und der materialen Grundlage eines Textes können sich Ganzheitshinweise auf verschiedenen Ebenen befinden. Im Falle eines Buches (vgl. Abb. 1) gehören dazu sprachlich-typographische Hinweise wie der Titel (z.B. Wie Kinder soziale Phantasie entwickeln), Titeleien (Titelangaben) wie Autorenangaben (z.B. Gudula List), Verlagsangaben (z.B. narr/francke/attempto) und die Angabe der ISBN-Nummer (vgl. Abb. 1). Derartige Angaben sollen dazu dienen, im Inneren des Textganzen Anfang und Ende zu markieren. Dabei stehen die Ganzheitshinweise, wenn die Textgrenzen den materialen Grenzen des Zeichenträgers entsprechen, zumeist an einem prominenten Ort für die typographische Gestaltung, auf dem Einband. Dies ist bei Büchern ebenso der Fall wie etwa bei umfangreicheren Werbeprospekten (vgl. Abb. 2). Hier stehen an Stelle eines Titels und des Autorennamens der Name des beworbenen Produkts und des Herstellers/des Unternehmens.
Verlagsprospekt (Narr/Francke/Attempto-Verlag „Neuheiten\1. Halbjahr 2016“)
Ferner können zu den Ganzheitshinweisen diejenigen Elemente gezählt werden, die darauf aufmerksam machen, dass der „eigentliche“ Textinhalt erst beginnt bzw. an dieser Stelle bereits endet. Dazu gehören Begrüßungs-, Anrede- und Verabschiedungsformeln ebenso wie das Wort Ende bei bestimmten Textsorten. Gerade bei den Eröffnungs- und Beendigungshinweisen kann vielfach jedoch keine scharfe Unterscheidung zwischen Ganzheits- und Gliederungshinweis vorgenommen werden. So sind in jedem Fall bei einem Zeitungsartikel die Überschrift und das Kürzel des Autorennamens bzw. der Agentur als Ganzheitshinweis, also als innersprachlicher Abgrenzungshinweis, anzusehen, zugleich stellt gerade die Überschrift ein wichtiges Gliederungsmerkmal der Textsorte dar. Wie die Beispiele zeigen, werden Textgrenzen zudem oft mehrfach angezeigt. Im Falle eines Briefes können dies z.B. die materiale Einheit, sprachlich-typographische oder metasprachliche Hinweise (z.B. Post Scriptum) sein.
Gliederungshinweise beziehen sich stets auf ein Textganzes, dessen innere Struktur weiter unterteilt werden kann. Dazu gehören Hinweise, die dazu beitragen, dass ein Textganzes in Teiltexte eingeteilt werden kann, die Teiltexte in weitere Teiltexte, wodurch sich eine hierarchische Relation zwischen textuellen Unter- und Obereinheiten ergibt.
Genauso wie bei den Abgrenzungshinweisen kann bei den Gliederungshinweisen zwischen textinternen und -externen unterschieden werden. Außersprachliche Gliederungshinweise ergeben sich in vielen Texten gleich auf den ersten Blick durch das Druck- oder Schriftbild (Drucksatz) und die darin zum Ausdruck kommenden typographischen Möglichkeiten der Textgestaltung, des Layouts (z.B. Zeilenumbrüche, Freiräume, links- und rechtsbündiger Druck). Die Synthese von außersprachlichen und innersprachlichen Gliederungshinweisen zeigt sich beispielsweise deutlich bei Überschriften oder Titeln, die zum einem über einer textuellen Einheit stehen und graphisch durch verschiedene Mittel hervorgehoben werden können (andere Schriftgröße, Fettdruck usw.) und sich zum anderen durch eine bestimmte Musterhaftigkeit auf der sprachlichen Ebene auszeichnen.
Für innersprachliche Gliederungshinweise soll hier – analog zum Begriff des stilistischen Handlungsmusters – der Terminus ‚Musterhinweis‘ vorgeschlagen werden. Musterhinweise bestehen zunächst aus metakommunikativen Hinweisen wie dem Wort Inhaltsverzeichnis oder der Überschrift Zu diesem Buch in diesem Lehrbuch. Musterhinweise ergeben sich zudem durch das Vorhandensein bestimmter Textelemente wie z.B. der Dachzeile, der Hauptzeile/Schlagzeile und der Unterzeile in journalistischen Textsorten oder der Adresse des Empfängers, der Anschrift des Empfängers, der Orts- und Datumsangabe, der Betreffzeile, der Anrede und Mitteilung sowie der Grußformel und Unterschrift bei einem Geschäftsbrief. Wie die Beispiele zeigen, sind Hinweise auf Musterhaftigkeit – ebenso wie andere Gliederungs- und Abgrenzungshinweise – immer auch Hinweise auf Textsorten oder Kommunikationsbereiche, die aus der Vertrautheit von Lektüreanlässen und Lektürekontexten resultieren und sich folglich wahrnehmungs- und wissensabhängig ergeben. Dies betrifft in besonderem Maße auch die Musterhaftigkeit des textuellen Gewebes, die sich einerseits in komplexen stilistischen Merkmalen wie den konvergenten und divergenten stilistischen Mustern (vgl. Kap. 3.3), andererseits in speziellen, durch die Textanordnung bedingten Hinweisen spiegelt.
Modelle für Musterhinweise, die aus der Textanordnung resultieren, gelten als typisch für den Kommunikationsbereich der Belletristik und die damit verbundene primäre Textfunktion ‚Ästhetisch Unterhalten‘. Aus dieser Unterhaltungsfunktion ergibt