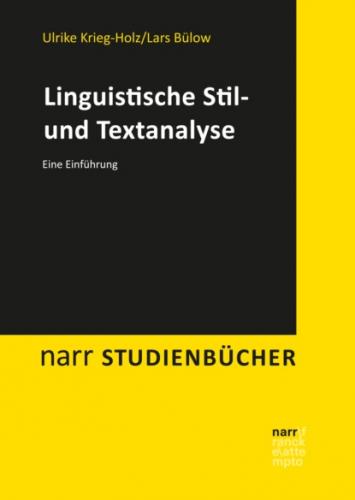Definition:
Die Textlinguistik ist eine sprachwissenschaftliche Disziplin, die sich mit den formalen und funktionalen Eigenschaften von schriftlichen Texten beschäftigt. Im Fokus stehen dabei die satzübergreifende Analyse sprachlicher Regularitäten und das Ziel, die konstitutiven Merkmale der sprachlichen Einheit ‚Text‘ zu bestimmen.
In anderen Sprachwissenschaften hat die Textlinguistik mitunter eine andere Position. So wird sie im angloamerikanischen Raum in der Regel als Teilbereich einer umfassenden Diskursanalyse (discourse analysis, DA) gesehen.
Weiterführende Literatur:
Coseriu, Eugenio: Textlinguistik. Eine Einführung. Narr Francke Attempto, Tübingen 2007.
Hausendorf, Heiko/Kesselheim, Wolfgang: Textlinguistik fürs Examen. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2008.
Schubert, Christoph: Englische Textlinguistik. Eine Einführung. Erich Schmidt, Berlin 2008.
1.1 Textualitätsmerkmale
Im Gegensatz zum Alltagsverständnis von Text beruhen sprachwissenschaftliche Textdefinitionen auf Überlegungen zu den Kriterien, die einen Text zu einem Text machen, die also die Bedingung für Textualität sind. Sie werden im folgenden Textualitätsmerkmale genannt.
Eine frühe, über lange Zeit etablierte Textdefinition stammt von de Beaugrande/Dressler (1981), die davon ausgehen, dass genau sieben dieser Textualitätsmerkmale erfüllt sein müssen, damit ein Text zustande kommt. Es sind die Kriterien:
Kohäsion
Kohärenz
Intentionalität
Akzeptabilität
Informativität
Situationalität
Intertextualität
Das erste der sieben Merkmale ist die Kohäsion. Sie bezieht sich auf die Art, wie Texte auf der Textoberfläche durch grammatische Formen miteinander verbunden sind. Bei dieser grammatischen Beziehung zwischen den Einheiten eines Textes handelt es sich häufig um satzübergreifende Relationen, d.h. solche Phänomene, die für eine transphrastische Analyse von Bedeutung sind.
Das Merkmal der Kohärenz umfasst nicht die grammatischen Mittel, sondern die Bedeutungsaspekte von Texten wie etwa Kausalitäts-, Referenz- und Zeitbeziehungen, also die inhaltlichen Zusammenhänge. Es geht dabei um die Herstellung und um das Verstehen von Textsinn durch die Verknüpfung des im Text repräsentierten Wissens mit dem Weltwissen der Kommunikationsbeteiligten. Sinn bedeutet in diesem Zusammenhang die im Text aktualisierte Bedeutung eines sprachlichen Ausdrucks, Textsinn die Gesamtheit der einem Text zugrunde liegenden Sinnrelationen, die mit der realen Welt natürlich nicht übereinstimmen müssen.
Die beiden Merkmale Kohäsion und Kohärenz gehören zu den textinternen Merkmalen von Texten, eben weil sie sich auf die inhärente grammatische und semantische Struktur eines Textes beziehen. Demgegenüber gelten die übrigen Merkmale als textexterne, die die kommunikativen und pragmatischen Eigenschaften von Texten betreffen.
Das Kriterium der Intentionalität bezieht sich auf die Absicht des Textproduzenten, einen kohäsiven und kohärenten Text zu erzeugen, um ein bestimmtes kommunikatives Ziel zu erreichen. Mit dem Kriterium der Akzeptabilität wird die Erwartung des Textrezipienten beschrieben, dass ein Text zusammenhängend und für ihn in irgendeiner Weise nützlich oder relevant ist.
Unter Informativität wird das Ausmaß an Erwartbarkeit oder Bekanntheit der dargebotenen Textelemente verstanden. Das bedeutet, je weniger die Inhalte erwartet oder bekannt sind, umso höher ist der Grad an Informativität. Um Textualität herzustellen, ist dabei jedoch ein Mindestmaß an neuer Information notwendig.
Mit dem Kriterium der Situationalität wird versucht, die Faktoren zu beschreiben, die einen Text für eine Kommunikationssituation relevant machen. Dazu gehört beispielsweise der Aspekt der juristischen Relevanz, der dazu führt, dass Verträge oder Versicherungspolicen in der Regel länger sind als ein Kochrezept.
Das letzte Kriterium ist die Intertextualität, die auf zweifache Weise verstanden werden kann: 1. als Bezug auf die Textsorte und 2. als Bezug auf andere Texte. Im ersten Fall geht es um die Differenzierung von Klassen von Texten mit typischen Mustern von Eigenschaften. So haben Kleinanzeigen, Beipackzettel, Bedienungsanleitungen oder Sonette bestimmte formale und inhaltliche Merkmale. Im zweiten Fall betrifft Intertextualität bestimmte Textsorten wie Kritiken, Buchbesprechungen oder Parodien, bei denen das Verständnis stark von der Vorkenntnis anderer Texte, auf die Bezug genommen wird, abhängt.
Auch wenn die genannten Kriterien von vielen Autoren aufgegriffen werden, bedeutet dies durchaus nicht, dass sie allgemein gültig und unumstritten sind. Nach wie vor sind die Bestimmung von Textualitätsmerkmalen und die damit verbundene Terminologie vielfältig. Als unverzichtbar wird in der Regel die Kohärenz dargestellt, da sie sich auf die Sinnkontinuität eines Textes bezieht. Diese wird vielfach als das dominierende Textualitätsmerkmal angesehen, weil sie zentral für das Zustandekommen eines Textes ist. Das erklärt zugleich auch, warum ein einzelnes Wort (wie das oben genannte Prüfung!) hier nicht als prototypischer Text betrachtet wird, denn in diesem Fall erübrigt sich natürlich das Kriterium der Kohärenz.
Das Kriterium der Kohäsion, der grammatischen Abhängigkeiten und semantischen Beziehungen in einem Text, scheint auf den ersten Blick sehr wichtig. Sie kann jedoch fehlen, wie der folgende Text – ein Gedicht von Sarah Kirsch, bei dem in großen Teilen auf Kohäsion verzichtet bzw. bewusst gegen ihre Regeln verstoßen wird – zeigt:
Ich in der Sonne deines Sterbemonats
Ich in der Sonne deines Sterbemonats
Ich im geöffneten Fenster
Ich betreibe Gewohntes: trockne
Gewaschenes Haar
Schaukeln fliegen
Am Augenwinkel vorbei, Wespen
Stelzen auf faulenden Birnen
Angesichts weißer Laken
Schreit der Wäschereihund: er ist noch klein
Flieg Haar von meinem Kamm
Flieg zwischen Spinnenfäden
Schwarzes Haar totes Haar
Eben noch bei mir
(Sarah Kirsch1)
Dessen ungeachtet soll Kohäsion hier als Textualitätsmerkmal definiert werden, weil wohl die Mehrzahl aller Texte über diesen an der Textoberfläche signalisierten Zusammenhang verfügen. Texte, die (die Regel bestätigende) Ausnahmen davon bilden, kompensieren fehlende Kohäsion häufig – so zeigt auch das o.g. Gedicht – durch Musterhaftigkeit, im Sinne einer besonderen Strukturiertheit. Bei zahlreichen Texten bzw. Textsorten treten Kohäsion und Musterhaftigkeit kombiniert auf. Das heißt, diese Texte können überwiegend kohäsiv sein (Fließtext), zugleich jedoch Bestandteile aufweisen (z.B. Überschriften, Schlagzeilen), die an der Oberfläche allein durch die Musterhaftigkeit des Textes/der Textsorte die Zusammengehörigkeit der Textelemente anzeigen. Aus diesem Grund wird das Textualitätsmerkmal Kohäsion im Folgenden ergänzt durch das Kriterium der Musterhaftigkeit. Musterhaftigkeit bezieht sich auf die Beschreibungsebene der Textgliederung, also die äußere Form und Strukturiertheit von Texten. Sie schließt ein weiteres wichtiges Kriterium für die Definition von Texten scheinbar unweigerlich mit ein: die Begrenztheit.
Das