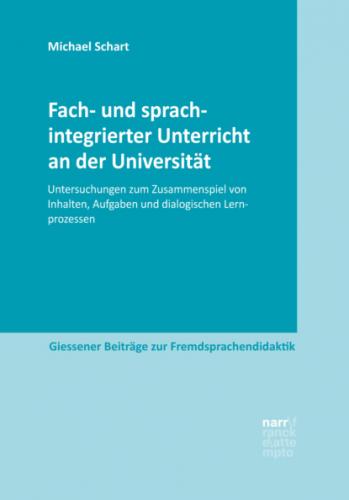Long (2015:251) argumentiert in diesem Sinn, wenn er das besondere Potenzial elaborierter Texte hervorhebt. Die Bearbeitung originaler Texte muss keineswegs zu inhaltlich weniger anspruchsvollem Material führen. Es geht nicht um Vereinfachung, sondern um die Integration von Redundanzen, sprachlichen Regularitäten, Paraphrasen, Wiederholungen oder expliziten Signalen, die das Verständnis der Niveaustufe entsprechend erleichtern. „Amplify, don‘t simplify“ lautet die griffige Formel, in der Walqui/van Lier (2010:39) diesen Denkansatz fassen. Ein Text kann also durch die Bearbeitung an Komplexität gewinnen, aber für Lernende dennoch zugänglicher werden. Und gerade wenn das gelingt, kann man von einem authentischen Lerntext sprechen. Letztlich wird daher die Lehrperson erst durch die gezielten Eingriffe in das Original ihrer pädagogischen Verantwortung gerecht (van Lier 1996:128; Widdowson 1990/ 2010).
Festzuhalten bleibt, dass die Vorbereitung von Materialien, die den Lernenden die Begegnung mit realistischen Beispielen des Sprachgebrauchs ermöglichen, ohne sie zu überfordern, eine sehr anspruchsvolle, zeitaufwändige Phase bei der Konzipierung fach- und sprachintegrierten Unterrichts darstellt (siehe auch Long 2015:249).
Um das Verständnis der Lernenden für das Zusammenspiel von sprachlicher Struktur und Funktion zu unterstützen, spielen neben diesen elaborierten Texten aber auch die Aufgabenstellungen eine wichtige Rolle. Sie sind häufig so gestaltet, dass sich für ihre Bewältigung bestimmte sprachliche Formen anbieten. Die Lernenden erhalten dadurch eine Orientierung, sollen aber zugleich nie in ihrer Kreativität beim Gebrauch sprachlicher Mittel übermäßig eingeengt werden.1
Ein weiteres wichtiges Element der geplanten Maßnahmen für die Unterstützung des sprachlichen Lernens sind schließlich auch die von den Studierenden selbst gestalteten Reflexionsphasen, die regelmäßig stattfinden. Jeweils zwei Studierende führen Protokoll über die vier Unterrichtseinheiten einer Woche. Aus ihren Notizen zur Interaktion im Unterricht, zum Tafelbild und aus dem Lernmaterial wählen sie sich sprachliche Phänomene aus, die sie für interessant halten oder noch nicht verstanden haben. Sie untersuchen diese zunächst selbstständig, stellen sie dann auf der Lernplattform zur Diskussion und besprechen sie abschließend im Plenum mit der gesamten Lerngruppe, wobei sich die Lehrperson im Hintergrund hält und nur bei Schwierigkeiten oder Missverständnissen eingreift. Diese Reflexionsphasen werden allerdings auf Japanisch durchgeführt und sind daher kein Teil der Interaktionsdaten, die in dieser Studie analysiert werden.
Inhaltlicher Fokus
Der Blick auf die Förderung der fremdsprachlichen Kompetenzen sollte verdeutlichen, wie wir uns an Longs Konzept des focus on form (Long 1991) uorientieren und von der ersten Unterrichtsstunde auf die Inhalte das Hauptaugenmerk legen. Auch wenn sich die inhaltliche Gestaltung entsprechend der sprachlichen und fachlichen Entwicklung der Studierenden verändert, so zielen doch die Planungen auf allen Niveaustufen des Intensivprogramms darauf, Lernräume zu schaffen, in denen die akademische Neugier gefördert wird und die kritische Auseinandersetzung mit sozialen, politischen und juristischen Fragen im Zentrum steht.1
Gerade in den ersten Lernmonaten geht es dabei um Gegenstände, die sich auch in jedem kommunikativen Lehrwerk finden, etwa das Thematisieren der eigenen Person und des unmittelbaren Lebensumfelds. Die grundlegende Idee des gesamten Programms liegt jedoch darin, solche Themen möglichst mehrperspektivisch anzugehen, zur Auseinandersetzung mit dem Gewohnten anzuregen und dabei, soweit möglich, auch wissenschaftliche Betrachtungsweisen einzubeziehen. Das Ziel sind somit eher disziplinbezogene Inhalte als disziplindeterminierte Inhalte, wie Widdwson (2010) diesen Unterschied begrifflich markiert. Konkret bedeutet das beispielsweise, dass wir uns in den ersten Wochen des Unterrichts nicht nur damit beschäftigen, wer wir sind oder welche Hobbys wir pflegen. Es werden zugleich auch die gesellschaftlichen Rollen thematisiert, die unser Handeln und Fühlen in bestimmten Situationen beeinflussen. Aus der unterschiedlichen Wahrnehmung von Rollen wie „ältester Sohn/älteste Tochter“, „Studentin/ Student“, „Frau/Mann“ oder „Japanerin/ Japaner“ ergeben sich bereits in den ersten Unterrichtsstunden Anknüpfungspunkte für jene Differenzerfahrungen, in denen Bonnet/Breitbach (2013:28) das besondere Bildungspotenzial fach- und sprachintegrierten Unterrichts sehen.
| Studienjahr (Niveaustufen) | Leitbegriffe | Beispiel für thematische Schwerpunkte |
| 1. Studienjahr (A0- A1/2) | Identität | personale Identität und soziale Rollen Dinge und Identität Beziehungen zu Menschen Beziehungen zu Orten |
| 2.Studienjahr (A1/2- B1) | Generation | Lebensziele, Lebenswege und gesellschaftliches Engagement „Erwachsen werden“ in Deutschland und Japan Geschlechterbeziehungen |
| 3./4. Studienjahr (B1- B2/C1) | Gesellschaft (Recht und Gerechtigkeit) | Politische Kultur Rechtskultur und Gerechtigkeit Migration und Integration Demografischer Wandel und Bevölkerungspolitik Widerstand, Protest und gesellschaftliche Umbrüche Geschichts- und Identitätspolitik |
Tab. 2.2:
Thematische Gestaltung des Intensivprogramms für Deutschlandstudien an der Juristischen Fakultät der Keio Universität Tokio (pro Studienjahr ca. 60 UE à 90min)
Wie Tab. 2.2 verdeutlicht, bezieht sich die inhaltliche Planung im ersten Studienjahr schwerpunktmäßig auf die verschiedenen Facetten von Identität, integriert in den folgen Studienjahren aber mehr und mehr gesellschaftspolitische und juristische Aspekte (siehe dazu auch Kap. 2.5.3). So entfaltet sich im zweiten Studienjahr die thematische Gestaltung anhand des Leitbegriffs „Generation“. Daher kommen beispielsweise die Entwicklungsaufgaben zur Diskussion, die junge Menschen beim Hineinwachsen in eine Gesellschaft bewältigen müssen. In den letzten beiden Studienjahren stehen mit Leitbegriffen wie „Soziale Gerechtigkeit“, „Politische Kultur“ oder „Demografischer Wandel“ die Fachinhalte im Vordergrund. Sie werden jeweils über ein gesamtes Semester oder auch Studienjahr hinweg bearbeitet.
Das Bestreben, die politische Bildung der Studierenden umfassend zu fördern, schlägt sich in der Konzeption der oberen Niveaustufen am deutlichsten nieder. Dass es seinen Ausdruck aber ebenso in den Kursen auf Grundstufenniveau findet, möchte ich an zwei Beispielen illustrieren. Diese sind nicht zuletzt auch deshalb von besonderem Interesse, weil die entsprechenden Unterrichtssequenzen eine wichtige Datengrundlage für die vorliegenden Studie bilden.
Zwei Beispiele
Die beiden Sequenzen, die ich im Folgenden kurz beschreiben möchte, spiegeln die inhaltlichen Gestaltungsprinzipien im Unterricht des ersten Studienjahres wider. Sie wurden in zwei unterschiedlichen Lerngruppen nach 7-8 Lernmonaten behandelt und sind beide eingebettet in einen größeren Themenkomplex, der sich über das gesamte zweite Semester erstreckt und sich der Frage widmet, wie unsere Identität geprägt wird durch die Dinge, die uns