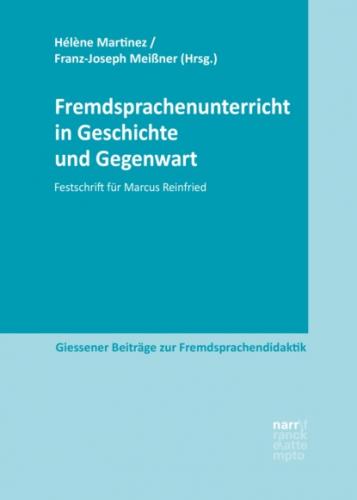Das Identifikationsversprechen ist Ausdruck eines Französischunterrichts um 1700, dessen übereinstimmende Elemente in den Wünschen der Lernenden bestanden nach Übernahme des Kulturmodells des zentralistischen Absolutismus, der Sprache und Kultur des französischen Hofes in Versailles und der großbürgerlichen Salons in Paris. Mit dem Erlernen der französischen Sprache verbanden viele Lernende aus den deutschen Oberschichten den Wunsch nach Aneignung des aristokratischen Leitbildes der Honnêteté und des distinguierten galanten Verhaltens (conduite galante). Sie lernten ein Französisch, in dem das Mündliche (neben dem Briefeschreiben) dominierte und übernahmen damit zugleich eine gesellschaftlich hoch angesehene Gesprächskultur.
Die Gründe für den Transfer der französischen Sprache und Kultur in die Oberschichten im Alten Reich sind bekannt: Französisch bedeutete Modernität im Vergleich mit dem Lateinischen. Vor allem nach dem Dreißigjährigen Krieg wollten sich die Fürsten allmählich von den alten Reichsinstitutionen absetzen, deren Amtssprache das Latein war. Französisch bedeutete Wiederaufbau des Landes durch Nachahmung der Franzosen, Aufgeschlossenheit für den kulturellen Glanz, der aus Versailles und Paris herüberstrahlte, und es bedeutete schließlich für die Territorialfürsten auch die Übernahme von Elementen des französischen Modells eines zentralistischen Absolutismus in ihre zum Teil kleinen und kleinsten Duodez-Fürstentümer mit all den repräsentativen Bauten, ob sie Monrepos oder Sanssouci heißen, mit dem französischen Hofzeremoniell oder einer französischen Theatertruppe. Die Offenheit der Landesherren der französischen Kultur und dem politischen Modell des zentralistischen Absolutismus gegenüber stimulierte auch die Bereitschaft in ihrem Umkreis, die französische Sprache zu lernen, und diese Offenheit bezog sich nicht nur auf die Sprache selbst, sondern auch auf deren Vermittler. Die Vorbehalte gegenüber dem Typus des ,windigen und unmoralischen Tanz- und Sprachmeisters‘ waren allerdings untergründig bereits lange vorhanden; so galt es, sich als Repräsentanten einer überlegenen Kultur darzustellen, die man mit der Sprache für seine Kinder einkaufte.
3 Unter dem Schutz des Landesherrn: Sachsen
Die Zahl der kleinen Prinzen und Prinzessinnen im Alten Reich war bei weitem nicht groß genug, um die enormen Verkaufszahlen des Lehrbuchs zu erklären. Die vielen adligen und bürgerlichen jungen Leute, dazu neuerdings auch ,die Frauenzimmer‘ und solche, die kein Latein konnten, mussten zum Kauf des Lehrbuchs animiert worden sein. Die beginnende Expansion des lernenden Publikums1 drückt das nächste Frontispiz (Abb. 3) aus: Es weitet die Zahl der Lernenden über den Erbprinzen aus auf den kindlichen Hofstaat, mit dem sich der Nachwuchs des kleinen und mittleren Adels identifizieren konnte – und auf alle die bourgeois gentilhommes, die es nicht nur in Molières Komödie gab.
Der Schriftzug „Grammaire Royale“ verschwindet aus der Illustration und macht Platz für ein übergroßes Bildnis des Landesherrn. Der Landesherr vergab nicht nur das Druckprivileg, er verkörperte zugleich die Vorzüge des Französischlernens und lokalisierte es am Hof als dem sozialen Ort, von dem der Sprachmeister und der Verlag sich die größte Attraktivität für ihre Kundschaft versprachen.
Des Pepliers, Grammaire Royale. Leipzig: Weidmann 1740.
Ausweislich des Druckprivilegs des Weidmann-Verlags muss es sich um August den Starken handeln, der auf seiner 23 Monate dauernden Grand Tour von Ludwig XIV. in Versailles in Audienz empfangen wurde und in Paris Französisch lernte, der des Französischen in Wort und Schrift mächtig war und der ein elegantes, wenn auch reichlich fehlerhaftes Französisch schrieb. Damit trug die aktuelle Illustration des Lehrbuchs der starken Stellung des Landesherrn Rechnung, der die Herrschaftsgewalt in seinem Territorium ausübte und bei juristischen Auseinandersetzungen, die bei dem Erfolg des Lehrbuchs nicht ausblieben2, hoheitlichen Schutz gewähren konnte. Diesen juristischen Schutz benötigte der Leipziger Verleger dringend, denn der Berliner Verleger Johann Christoph Papen, der 1723 vom preußischen König Friedrich Wilhelm I. das Druckprivileg erhielt, machte ihm die Druckrechte streitig. Allerdings: Berlin war preußisch und die Messestadt Leipzig sächsisch. Deshalb konnte der Weidmann-Verlag unter dem Schutz des sächsischen Landesherrn seine lukrativen Versionen des Lehrbuchs noch lange (z. B. mit den Auflagen von 1765 und 1767, d. h. auch noch nach der Schwächung des sächsischen Kurfürstenstaates im Siebenjährigen Krieg) weiter publizieren.
4 Vom Hof zur Stadt oder: von Ludwig XIV. zu Friedrich dem Großen
Des Pepliers, Grammaire Royale. Berlin: Haude 1742.
Bereits in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts geht die Integration des Bildprogramms in die kulturpolitischen Verhältnisse des Alten Reiches weiter. Insbesondere der Gründungsmythos der Grammaire Royale, der direkte Bezug auf die Télémaque-Szene, wird im Frontispiz der Berliner Auflage von 1742 nicht mehr realisiert. Der Sprachmeister, der daher auch nicht mehr Mentor ist, wird ganz aus dem Arrangement entfernt, ebenso die klar strukturierte barocke Portalarchitektur und die beiden Allegorien von Diligentia und Constantia. Nur die Tafel an der Bildbasis und das darauf abgelegte Lehrbuch verweisen noch auf Des Pepliers‘ Grammaire Royale. Die Göttin Athene wird verfremdet zu einer Frauenfigur, die im Mittelgrund auf einer Säule museal erstarrt ist und daher den rechten Weg zum Lehrbuch nicht mehr weisen kann. Der Prinz ist nun von der Last des Buchwissens und dessen mühevoller Aneignung befreit, weil ihm eine modische Rokoko-Dame mit anliegender jupe und flatterndem Mantel den direkten Weg zum Herrscherportrait weist, in dem wir wahrscheinlich den zum preußischen König aufgestiegenen Friedrich Wilhelm I. identifizieren können. Er ist in Lederkürass dargestellt, mit Schärpe, Kurzperücke und hochtoupierter Lockenrolle über dem Stirnansatz.1 Die Devise „Sub umbra alarum tuarum“ [protege me] (Psalm 17, 8. Lutherübersetzung: „Beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel“) appelliert an den Schutz der Druckrechte garantierenden Landesherrn.
Eine ähnliche Prachtuniform trägt der wenig individuell dargestellte Prinz, in dem wir uns den jungen Friedrich II. denken können, der widerwillig die militärische Erziehung seines Vaters ertrug, sich jedoch mit großer Freude die französische Sprache und Literatur aneignete. Statt der mythologischen Göttin Athene werden nun Putten in das Gestaltungskonzept einbezogen. In kindlicher Begeisterung für die Standards der französischen Sprache zeigt die größere Engelgruppe rechts auf eine aufgeschlagene Buchseite, auf der links ein Hinweis auf das Buch der Richter (Kap. 12, v. 4.6) steht, daneben der Spruch „Si volet usus“. Mit dem Horaz (Ep. ad Pis. 70-72) entlehnten Spruch (etwa: „wie es dem Sprachgebrauch/der Sprachnorm entspricht“) versichern Autor und Verleger, dass die Käufer mit diesem Lehrbuch eine zeitgemäße französische Sprache erwerben konnten (die Distinktion und Prestige verhieß).
Welche Gefahr diejenigen liefen, die nicht den richtigen, sozial privilegierten Akzent des Französischen (gemeint ist: mit einem anderen Lehrbuch und einem anderen Sprachmeister) erwerben, wird mit nichts weniger als einer Szene aus dem Alten Testament anschaulich gemacht. Im Kapitel 12 des Buchs der Richter wird der Kampf zwischen den israelitischen Stämmen der Gileaditer und Ephraimiter geschildert. Die flüchtenden Ephraimiter, die das Wort Schibboleth nicht mit kanaanäischem „th“ aussprechen konnten (und sich somit als Feinde zu erkennen