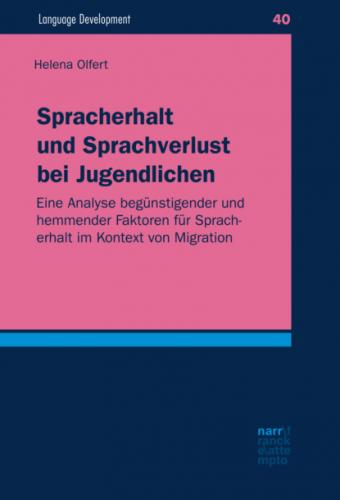Die vorliegende Arbeit widmet sich dem dritten Punkt dieser Liste an Forschungsdesiderata und untersucht, zu welchem Ausmaß unterschiedliche außersprachliche Faktoren den Erhalt bzw. den Verlust der HL beeinflussen können und welche von ihnen dabei den größten Effekt aufweisen.
2.6 Zusammenfassung
Die Frage danach, ob eine Sprache auch nach der Migration in der Familie erhalten bleibt und an folgende Generationen weitergegeben wird, hängt stark mit dem Wert und Prestige zusammen, der ihr gesellschaftlich beigemessen wird. Dieses Sprachprestige ist dabei kein objektiv gesetztes Maß, sondern reflektiert gesellschaftliche Machtverhältnisse und wird durch alle Bildungseinrichtungen hindurch reproduziert. Sprachen in der Peripherie des nationalen Sprachgefüges unterliegen besonders großen Restriktionen bei ihrer Weitergabe an Folgegenerationen, sodass ihre Sprecher einem umso stärkeren Rechtfertigungsdruck im Falle eines Wunsches nach Spracherhalt ausgesetzt sind. Zahlreiche Forschungsbefunde stellen zudem migrationsbedingte Mehrsprachigkeit als einen Sonderfall sprachlicher Sozialisation und als einen Risikofaktor im deutschen Bildungssystem dar. Ursachenforschung zu den festgestellten Disparitäten zeigt jedoch, dass es nicht zwingend die Mehrsprachigkeit an sich ist, die zu Bildungsbenachteiligung führt, sondern daran gekoppelte sozio-strukturelle Merkmale sowie Eigenschaften der Institution Schule selbst. Für den Erhalt der Minderheitensprache existiert wiederum eine Fülle an Argumenten aus unterschiedlichsten Disziplinen. Sie attestieren Mehrsprachigen u.a. kognitive Flexibilität, Vorteile beim Lernen von Fremdsprachen oder emotionale Stabilität. Zugleich deuten viele Studien darauf hin, dass diese Ressource nur von balanciert Mehrsprachigen ausgeschöpft werden kann, was ein weiteres Argument für die Förderung der Minderheitensprache ist. Dass migrationsbedingte Mehrsprachigkeit kein Randphänomen darstellt, verdeutlichen wiederum unterschiedliche Migrationsstatistiken und Spracherhebungen an Grundschulen. Sie zeigen, dass es sich unter den fünf am häufigsten in Deutschland gesprochenen Sprachen um zentrale bis superzentrale Sprachen handelt, die ihre Randomisierung erst in der Migrationssituation erfahren. Ihre Förderung ließe sich nicht nur unter ökonomischen Gesichtspunkten rechtfertigen, sondern würde auch Anerkennung für die zahlreichen HL-Sprecher bedeuten. Nicht zuletzt verspricht die Beschäftigung mit HLs zum einen in Bezug auf die Theoriebildung, zum anderen hinsichtlich der unterrichtlichen Praxis zahlreiche Erkenntnisse für die Mehrsprachigkeitsforschung.
3 Forschungsstand zu Heritage-Language-Sprechern
3.1 Der Begriff „Heritage Language“ und seine Abgrenzung von anderen Termini
Der Begriff „Heritage Language“ (HL) ist in der deutschsprachigen Forschungslandschaft nicht weit verbreitet und findet nur begrenzt Anwendung in Studien mit Bezug zum Thema Mehrsprachigkeit. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, wird im folgenden Kapitel zunächst ausführlich auf seine Herleitung und definitorische Eingrenzung eingegangen. Gleichzeitig erfolgt eine Bestimmung anderer damit konkurrierender Ausdrücke, um die Notwendigkeit eines Rückgriffs ausschließlich auf diesen Terminus in der vorliegenden Studie zu begründen und hierdurch die Zielgruppe der Studie festzulegen und näher zu beschreiben.
3.1.1 Entstehung des Begriffs „Heritage Language“
„Heritage Language“ wurde als feststehender Fachausdruck laut Cummins (vgl. 2005: 585) zum ersten Mal in den 1970er Jahren im Zusammenhang mit dem Ontario Heritage Languages Program in Kanada verwendet. Das Programm diente der Initiierung und finanziellen Förderung von wöchentlichem HL-Unterricht und wirkte als Vermittler zwischen den einzelnen Communities und der Schule. Der Begriff selbst wurde im Rahmen dieser bildungspolitischen Maßnahme als „languages other than English or French“1 definiert. Diese nicht näher spezifizierte Definition lieferte keine weitere Beschreibung der Sprechermerkmale und fand folglich nur verzögert Eingang in die wissenschaftliche Diskussion. Erst im Laufe des sog. „Heritage Language Movement“ (Peyton et al. 2001: 4) in den 1990er Jahren wurde er in den USA von Pädagogen und Sprachlehrforschern weiter präzisiert.
Diese Bewegung verstand sich als eine bottom-up forcierte Abkehr von der monolingual orientierten Bildungspolitik der USA zu der damaligen Zeit und mündete in zahlreichen, von den Minderheiten selbst organisierten Schulen und Kursen vom Kindergarten bis zur universitären Ausbildung, die stufenweise in dem Bildungssystem verstetigt wurden (vgl. Fishman 2001: 89). Durch diese Entwicklungen fand der Begriff „Heritage Language“ und mit ihm der HL-Sprecher zunächst in den USA, Kanada und Australien immer mehr Beachtung durch die Forschung (vgl. Cho et al. 1997; Kondo 1997; Krashen et al. 1998). Inzwischen erlangten HLs – teilweise unter anderen Bezeichnungen – auch in Europa und in Deutschland immer mehr Aufmerksamkeit seitens der Forschungscommunity (vgl. Anstatt & Dieser 2007; Cantone et al. 2008; Cantone & Olfert 2015; Di Venanzio et al. 2012; Gagarina 2008; Kupisch et al. 2014).
Die in den ersten Publikationen verwendeten Definitionen beschreiben HLs als Minderheitensprachen (LOTEs – languages other than English), die ausschließlich innerhalb der Familie gesprochen sowie nicht schulisch vermittelt werden und zu denen der Sprecher eine persönliche, historisch bedingte Verbindung2 aufweist (vgl. Cho et al. 1997: 106; Krashen 1998: 3; Valdés 2001: 38), sie schließen also autochthone Minderheitensprachen ein. Fishman (2001) unterscheidet in a) indigene HLs von autochthonen Minderheiten in den USA, b) koloniale HLs wie Niederländisch, Schwedisch, Französisch und Deutsch, die bereits vor der Staatsgründung der USA durch erste Siedler eingeführt wurden, sowie c) migrationsbedingte HLs aktueller Einwanderer.
Diese Differenzierung begründet er zum einen mit der für ihren Erhalt verwendeten Rechtfertigungsstrategie, zum anderen mit den geschichtlich gewachsenen Gruppenmerkmalen, die sich auf die Weitergabe der HLs auswirken. So sei die Bewahrung indigener, autochthoner HLs nicht zuletzt von der Mehrheitsbevölkerung selbst erwünscht. Zurückzuführen sei dieser Wunsch auf den Ursprung indigener Bevölkerungsgruppen auf dem Territorium der USA, ihr Vorrecht darauf und auf eine ihnen gegenüber empfundene Kollektivschuld wegen der Zerstörung ihres kulturellen Erbes (vgl. ebd.: 83). Ähnliches lässt sich für den deutschen Kontext beschreiben, wo die autochthonen Minderheitensprachen Dänisch, Sorbisch und Friesisch als zu Deutschland zugehörig empfunden und durch die ECRM (vgl. Europarat 1992) offiziell geschützt werden. Ihr Erhalt wird in Deutschland auch durch die Mehrheitsgesellschaft stark begrüßt und gefordert (vgl. Gärtig et al. 2010: 227).3
Bei den im 17. Jahrhundert in den USA noch lebendigen kolonialen HLs fand laut Fishman kaum intergenerationale Sprachweitergabe statt, sodass die Nachkommen dieser ersten Einwanderer zum größten Teil inzwischen monolingual Englischsprachige sind (vgl. Fishman 2001: 84). Eine Ausnahme stelle das Deutsche dar, das in Form von Pennsylvania und Texas German aufgrund der Gruppengröße, des internationalen Kommunikationswerts der Sprache sowie der kulturellen und religiösen Abschottung seiner Sprecher bis in die heutige Zeit Bestand habe (ebd.). Neuere Studien zeigen indes, dass mit der voranschreitenden Öffnung beider Communities diese Sprachvarietäten ebenfalls nur noch von der älteren Generation gesprochen werden (vgl. Boas 2005: 82), sodass selbst in diesem Kontext Sprachverlust immer wahrscheinlicher wird. Eine vergleichbare sprachliche Konstellation ist im deutschen Kontext nicht gegeben.
Migrationsbedingte HLs hingegen verfügen über kein gesellschaftlich legitimes Argument, das ihren Erhalt rechtfertigen würde, und weisen gleichzeitig hinsichtlich der Gruppenmerkmale schlechtere Ausgangsbedingungen als die beiden erstgenannten Typen von HLs auf, weshalb ihre Förderung einer speziellen Beachtung bedarf. Obwohl Studien zu Spracherhalt aller drei genannten Gruppen vorliegen, befasst sich die heutige Forschung zu HLs primär mit dieser von Fishman hervorgehobenen dritten Gruppe, also mit allochthonen Minderheiten, deren Einwanderung zwei bis drei Generationen zurückreicht.4 Der Begriff „Heritage Language“ konnotiert heutzutage dementsprechend eine migrationsbedingte Mehrsprachigkeit. Diese Unterscheidung in allochthon und autochthon wird in Deutschland bei der Beschäftigung mit Minderheitensprachen ebenso grundsätzlich aufrechterhalten (vgl. De Bot & Gorter 2005: 612).
Der Terminus „Heritage