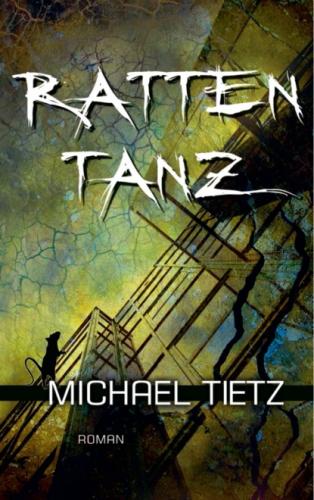»Warum sind Sie noch nicht in Ihrem Bett?«, fuhr er seinen Patienten wie ein unmündiges Kind an. Jost saß noch immer auf dem Rollstuhl und weigerte sich, sich ausziehen zu lassen.
»Wie lange soll ich hier bleiben?«, wandte er sich an den Arzt.
»Mindestens bis morgen früh. Solange brauchen wir, um eine akute Blutung einigermaßen sicher ausschließen zu können.«
»Können Sie vergessen. Ich gehe!« Jost wollte sich erheben, wurde aber von Stefan mit sanfter Gewalt zurück in den Stuhl gedrückt. Der versuchte zu beruhigen: »Herr Jost, Sie haben einen Schock nach dem Unfall. Sie sollten sich hinlegen. Wirklich! Wir geben Ihnen eine Infusion und in drei, vier Stunden geht es Ihnen dann sicher wieder besser.« Eva bereitete nebenher alles für eine Infusion vor.
»Nein!«, donnerte Jost. »Bringen Sie mir irgendwas, das ich unterschreiben kann und dann verschwinde ich.« Er stand auf und wollte einen Schritt Richtung Tür machen, musste sich aber von dem Pfleger stützen lassen.
»Merken Sie denn nicht selbst, dass Sie viel zu schwach sind?«
»Aber was soll ich denn machen?« Valentin Jost klang verzweifelt.
»Meine Frau und die Kinder sind zu Hause, kein Strom, kein Telefon. Sie wissen doch gar nicht wo ich stecke, wenn ich heute Abend nicht pünktlich zurück bin.«
»Lasst ihn gehen«, beendete Stiller die Diskussion und war innerlich froh, diesen nicht existenten Patienten so schnell wieder loszuwerden. »Er soll unterschreiben, dass er gegen ärztlichen Rat das Haus verlässt und Schluss.«
Aleksandr Glück musterte Eva mit einer Mischung aus väterlicher Fürsorge und Verliebtheit. »Alles ein bisschen viel für den kleinen Doktor?« Eva lächelte; der kleine Doktor. Das passte.
»Er mag es gern, wenn hier alles schön geordnet abläuft und er dabei das Gefühl hat, die Dinge im Griff zu haben.« Glück nickte.
»Aber heute geht alles drunter und drüber.«
»Und das macht dem kleinen Doktor Angst.«
»Richtig.«
Glück zog sich seine Bettdecke bis unters Kinn. »Und Ihnen?«
»Bitte?« Eva hatte die Frage sehr wohl verstanden, aber keine Antwort parat.
»Haben Sie Angst?«
Eva war in den vergangenen zwei Stunden seit dem Stromausfall kaum zum Nachdenken gekommen. Die überstürzte Verlegung der Patienten, die Hektik, die Stiller verbreitete, ihr eigener Zustand und die permanente Übelkeit sowie Valentin Jost hatten sie völlig in Anspruch genommen. Quasi nebenher versorgte sie noch Aleksandr Glück. Hatte sie Angst? Machte sie sich Sorgen? Evas Blick fiel auf den leeren Himmel hinter den hermetisch abgeschlossenen großen Fensterscheiben.
»Schwästerrr?«
Eva konnte nicht anders, sie musste lächeln.
»Schwester, wissen Sie, ein wenig Angst hat noch keinem geschadet. Ist es nicht ganz normal sich zu fürchten, wenn man sich plötzlich einer unerwarteten, fremden Situation gegenübersieht?«
»Lea, meine Tochter, sie ist erst sieben. Sie ist bei einer Nachbarin. Hoffe ich.«
»Und Ihr Mann? Sie haben doch einen Mann?«
Eva nickte. Sie spürte Tränen in sich aufsteigen. Für diesen Moment konnte sie sie noch hinunterschlucken, aber sie wusste, dass der Pegel in ihr langsam anstieg und irgendwann überlaufen musste. »Mein Mann ist gestern Morgen nach Schweden geflogen. Glauben Sie, dass nur hier Flugzeuge abstürzen? Bei meinem Mann wird doch alles in Ordnung sein, oder?«
Hans saß vielleicht irgendwo in Südschweden fest. Wie würde es für sie und wie für Hans weitergehen, sollte sich nicht alles schnell wieder normalisieren? Wie ging es Lea? Sie versuchte diesen Gedanken mit aller Macht aus ihrem Kopf zu verbannen, aber je stärker ihr Bemühen, so schien es, desto übermächtiger und klarer wurde dieser Albtraum! Weit über eintausend Kilometer lagen zwischen ihnen. Ganz Deutschland und die Ostsee.
Glück nahm Evas Hand und zog sie zu sich heran. »Darauf weiß nur Gott allein eine Antwort. Und Ihr Herz.«
»Mein Herz.« Eva starrte aus dem Fenster. »Ich weiß gar nicht, wie viele Menschen heute Morgen wohl ums Leben gekommen sein müssen. Keine einzige Maschine kreist mehr! Und alles passiert hier bei uns, keine zehn oder zwanzig Kilometer entfernt! Es macht mir Angst, dass so etwas passieren kann. Und dass es hier geschieht und nicht in Amerika oder Japan.« Sie streckte sich, griff mit beiden Händen hinter den Kopf und zog den blauen Haargummi straff, der ihre braunen Locken bändigte. »Wenn ich nur anrufen könnte und wüsste, wie es Lea und Hans geht.« Jetzt konnte sie die Tränen nicht länger zurückhalten.
»Mein Mädchen, komm, setzen Sie sich einen Moment zu mir.« Eva zögerte. »Oder haben Sie etwas Wichtigeres zu tun?«
»Sie haben keine Angst, oder?« Eva folgte der Einladung und setzte sich auf die Bettkante. »Sie wirken so ruhig … als könne Sie nichts mehr erschüttern.«
Aleksandr Glück hob die Augenbrauen. Über seine Lippen tanzte ein Lächeln − und Wissen.
»Wie lange liege ich jetzt schon hier?«, fragte er.
Eva wischte sich die Tränen mit dem Handrücken ab. »Vier Wochen«, antwortete sie.
Glück war vor vier Wochen der größte Teil des rechten Lungenflügels entfernt worden. Lungenkrebs, obwohl er, abgesehen von einer riesigen Zigarre zusammen mit Schulfreunden, niemals geraucht hatte. Lungenkrebs mit Metastasen in Leber, Darm und im Gehirn, wie in einer späteren Untersuchung festgestellt wurde. Die Diagnose war für den Einundsiebzigjährigen ein Hammerschlag. Als ob ihm im vollen Lauf jemand ein Bein stellte. Lungenkrebs. Vor der Operation machten ihm die Ärzte noch Hoffnung, sagten, er könne durchaus noch fünf, sechs Jahre leben, vorausgesetzt, das komplette Geschwür könne entfernt werden. Aber nachdem die Metastasen gefunden waren, hörte er keine konkreten Zahlen mehr, wenn er nach seiner Lebenserwartung fragte. Die Ärzte wichen seinen Fragen aus und wechselten das Thema oder vertrösteten ihn auf später. Und so verlegte er sich aufs Zuhören und Beobachten. Glück hörte zu und zählte eins und eins zusammen. Und begann zu verstehen.
Aleksandr Glück, aufgewachsen in einem sibirischen Lager, in dem während des Zweiten Weltkrieges Kollaborateure, unwichtige Kriegsgefangene und vor allem Deutschstämmige interniert waren, die generell Hochverrätern gleichgesetzt wurden, hatte früh gelernt, in der Stille der eigenen Gedanken die Dinge des Lebens zu verstehen. Und Entscheidungen zu treffen. Und so kam es für Professor Kellermann, der den Patienten noch in seliger Unwissenheit glaubte, völlig unerwartet, als der ihn bei einer der morgendlichen Visiten mit seinem Wissen um seinen baldigen Tod konfrontierte. Er bat den Chefarzt eindringlich um eine ehrliche Prognose. Kellermann legte sich auf höchstens sechs Monate fest, eher weniger.
Aber anders, als von seiner Umgebung erwartet, verfiel Glück nicht in Trauer und Resignation. Für das Gros derer, die mit einer solchen Aussage konfrontiert wurden, bedeutete das Rückzug und Depression. Sie verfielen in Selbstmitleid und ihre Gedanken kreisten, wie die Erde um die Sonne, unablässig um die eine, nie zu beantwortende Frage: warum ich?
Aleksandr Glück tröstete seine Frau, die, als er ihr die Nachricht versuchte schonend beizubringen, laut schreiend vor seinem Bett auf die Knie fiel.
»Wenn man, so wie ich, demnächst sterben muss, Schwester, dann verschieben sich die Relationen.« Er nahm ihre Hand. »Ich bin jetzt vier Wochen hier und an die meiste Zeit davon kann ich mich nicht erinnern.« Glück hatte achtzehn Tage im künstlichen Koma gelegen und war von Maschinen beatmet und ernährt worden. »Keiner weiß, warum die Flugzeuge abstürzen, warum kein Wasser läuft und …«
»… der Strom weg ist und keine Computer und Telefone funktionieren«, ergänzte Eva und putzte sich die Nase.
»Aber ich weiß«, fuhr Glück fort, »dass für mich heute ein schöner Tag ist. Sie sind hier Schwester und da die Station