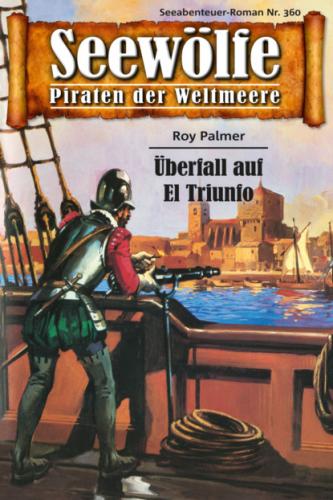Dennoch hatte der Marsch ein positives Ergebnis. Willem war seine gräßlichen Kopfschmerzen, die ihn nach der durchzechten Nacht mit der Queen, Caligula und Georges Buisson geplagt hatten, fast völlig los. Er konnte wieder klar denken. Ja, mit fast fröhlicher Miene, so konnte man sagen, trat er auf den Strand der Bucht und ließ den Blick seiner listigen schmutziggrauen Augen über die beiden Dreimaster gleiten, die da ankerten.
„Wunderbar“, sagte er. „So ein schöner Anblick.“ Er unterließ es jedoch, darauf hinzuweisen, daß die Bemerkung eher der Black Queen galt als den Schiffen. Immer wieder bedachte er sie mit Seitenblicken, die keine Fehldeutung zuließen. Schon in der Nacht hatte er versucht, sie mit seinen dicken Fingern anzufassen, hatte aber keinen rechten Erfolg gehabt. Trotzdem – es würde ihm noch gelingen, sie zu erobern. Davon war er felsenfest überzeugt.
„Nicht wahr?“ sagte die Queen und lächelte. „Der Zweidecker ist meine ‚Caribian Queen‘. Das andere Schiff ist die ‚Aguila‘. Sie hat achtundzwanzig Culverinen, vier Drehbassen und zwei Zwölfpfünder als Heckgeschütze.“
„Eine feine Armierung“, sagte Willem.
„Damit heizen wir den Spaniern ganz schön ein, wenn sie erscheinen“, meinte Georges Buisson, der den Trupp wieder begleitet hatte.
„Nicht so voreilig“, sagte einer von Tomdijks vier Leibwächtern. „Das hängt davon ab, wie groß der Verband ist, der uns angreifen soll.“
„Die Queen hat keine Angst“, sagte Buisson. „Weder vor zwei noch vor drei Dutzend spanischen Kriegsgaleonen.“
Er sah sie sehnsüchtig und entsagungsvoll zugleich an. Gern hätte auch er sich näher mit ihr befaßt, denn sie war eine Frau, die die Phantasie jedes Mannes anheizte. Schön in ihrer brutalen, unbezähmbaren Wildheit stand sie da und schaute triumphierend zu den Mannschaften der Schiffe. Sie hatte die Lage in der Hand, sie war die Herrin. Selbst Caligula, der riesige Schwarze, war nur ein williges Werkzeug in ihren Händen.
Caligula gab ein Zeichen zur „Caribian Queen“ und zur „Aguila“. Ein zweites Beiboot wurde abgefiert, bemannt und zum Ufer gepullt. Die Jolle der „Caribian Queen“ allein, die auf dem Sandstrand lag, reichte nicht aus, um die Queen, Tomdijk und deren Begleiter zu befördern.
Das Boot traf ein. Nur wenige Worte wurden gewechselt. Die Queen hatte es jetzt eilig, ihre Gäste an Bord der „Caribian Queen“ zu befördern. Die Jolle wurde ins Wasser geschoben, und die Männer kletterten an Bord beider Boote.
Das ging sehr rasch vonstatten. Nur Willem, der als letzter überenterte, hatte Schwierigkeiten mit dem Gleichgewicht. Er setzte einen Fuß in die Jolle der Queen, während er mit dem anderen – das Hosenbein hochgekrempelt – im flachen Wasser stand. Die Jolle sackte bedrohlich tiefer und krängte. Willem hatte nicht den richtigen Schwung, um sich ganz an Bord zu befördern. Er wankte, ruderte mit den Armen und drohte, ins Wasser zurückzukippen.
Zwei seiner Leibwächter, die schon im Boot saßen, griffen beherzt zu und packten seine Arme. Willem fluchte in seiner Muttersprache und versuchte erneut, einzusteigen. Ein wüstes Zerren und Hangeln begann, wobei anfangs nicht klar zu sein schien, wer der Sieger blieb: Die Leibwächter, die alles taten, um ihn in die Jolle zu hieven, oder Willem, der wie ein gewaltiger Mehlsack an ihnen hing und sie ins Wasser zu reißen schien.
Endlich griff der dritte Leibwächter mit zu, dann war auch der vierte heran, und gemeinsam wuchteten sie den massigen Mann an Bord. Willem ließ sich mit einem Ächzer auf die mittlere Ducht sinken und hielt sich an Backbord und Steuerbord fest, denn das Boot begann bedenklich zu kippen.
Buisson und die anderen saßen in dem zweiten Boot und konnten sich ein Lachen kaum verkneifen. Aber es mochte wohl der Gedanke an das sein, was bevorstand, der sie daran hinderte, laut loszuprusten.
Willem, die Witzfigur, wurde einer mächtigen Tonne gleich zur „Caribian Queen“ gepullt. Aber er war doch nicht nur witzig, dieser Willem Tomdijk, er war auch ein Schlitzohr und eine Krämerseele und rechnete sich sofort sämtliche Vorteile aus, die ihm durch das Auftauchen der Queen und ihrer Schiffe geboten wurden.
Schließlich mußte der Mensch zuallererst an sein persönliches Wohlergehen denken. Nach diesem Prinzip handelte Willem. Er hatte in der ehemaligen spanischen Mission von El Triunfo, die sein Hauptquartier war, eine Bierbrauerei eingerichtet. Davon lebte er.
Im übrigen verfuhr er nach dem Grundsatz, daß es ihm nur dann gutging, wenn das auch für alle anderen in seiner näheren Umgebung zutraf. Leben und leben lassen! Kein Mann in der frauenlosen Siedlung hatte je bereut, diesen Dicken zum Bürgermeister gewählt zu haben. Er nahm eine neutrale Stellung ein und wußte Entscheidungen durch Abstimmungen souverän herbeizuführen – das mußte man ihm lassen.
Die Boote schoben sich an der Bordwand der „Caribian Queen“ längsseits. Alle Insassen enterten an der bereithängenden Jakobsleiter auf, nur für Willem mußte schleunigst ein Bootsmannsstuhl abgefiert werden, ohne den er es nicht geschafft hätte, an Bord der Galeone zu gelangen.
Ein paar Flüche der Piraten, die Willem mittels der Taue hochhievten, ein sattes Schnaufen und Ächzen des Bürgermeisters, dann stand er auf dem Hauptdeck der „Caribian Queen“ und schaute sich vergnügt um.
Die Queen stand vor ihm und stemmte die Fäuste in die Seiten.
„Nun?“ fragte sie ihn. „Wie gefällt dir mein Reich?“
„Sehr gut, ich sagte es wohl schon.“
„Du siehst, wir haben hier sehr viel Platz.“
Er grinste. „Auf beiden Schiffen können gut und gern zweihundert Menschen befördert werden – was sage ich! Dreihundert!“
„Langsam, langsam“, sagte sie lachend. „Wir wollen die Einzelheiten unseres Planes erst noch eingehend besprechen. Wie wäre es mit einem Begrüßungstrunk?“
Etwas wehleidig verzog Willem sein rosiges Jungengesicht. „Im Moment kann ich höchstens einen Schluck Wasser annehmen.“
Caligula und die anderen Kerle, die sie umringten, lachten grölend. Willem betrachtete sie der Reihe nach. Auch Jaime Cerrana war inzwischen eingetroffen. Er hatte sich in dem Boot der „Aguila“ übersetzen lassen, denn er wollte sich nicht entgehen lassen, den Bürgermeister von El Triunfo persönlich zu begrüßen.
Es wurden also reihum die Hände geschüttelt, dann begann die Besichtigung der „Caribian Queen“. Willem bedachte Cerrana mit einem etwas mißtrauischen Seitenblick. Wer war dieser Kerl? Ein Spanier?
Er würde sich noch genauer über ihn informieren müssen. Jeder Spanier war in El Triunfo verhaßt, die Spanier waren die erklärten Feinde der englischen und französischen Siedler. Von ihnen konnte nur Unheil drohen.
Im Achterdeckssalon des Zweideckers legte die „Delegation“, die aus der Queen, Caligula, Buisson, Willem und den vier Leibwächtern bestand, vorerst eine Rast ein.
Willem ließ sich seufzend auf der Koje der Queen nieder, ohne viel zu fragen, breitete die Arme aus und sagte: „Queen, es ist das schönste Schiff, das ich je gesehen habe.“
In der Tat war er ganz besonders von diesem Salon angetan. Sofort bewegten sich seine Gedanken wieder in eine bestimmte Richtung. Wie würde es wohl sein, wenn er hier nächtigte, und wenn sie, die Black Queen, im Dunkeln sein Quartier betrat, nur bekleidet mit diesem lächerlichen Fetzen von einem Lendenschurz?
Sie schien seine Gedanken zu erraten und lächelte ihm aufreizend zu. „Vielen Dank für deine lobenden Worte. Selbstverständlich stelle ich dir meine Kammer für die Überfahrt nach Tortuga und Hispaniola zur Verfügung. Ich tue das gern für dich, Willem.“
„Danke. Tortuga und Hispaniola – das also ist das Land, wo wir alle sicher sind?“
„Ja.“
„Wir laufen aus und segeln davon, Bürgermeister?“ fragte einer der Leibwächter. „Das war uns noch gar nicht bekannt.“
„Moment mal, Moment mal“, sagte Willem. „Nur keine