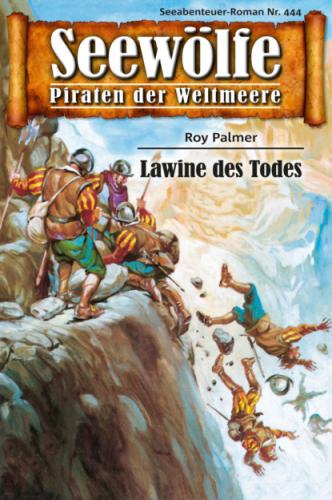„Auch die Soldaten?“ fragte Rubirosa.
„Auch die Soldaten“, entgegnete El Moreno gedämpft. „So, und jetzt halt’s Maul! Oder willst du, daß sie uns hören?“
Schweigend drangen sie in die Gassen ein. Ihre schemenhaften Gestalten bewegten sich huschend von Haus zu Haus. Aber sie waren nicht die einzigen. Weitere Schatten waren in den Gassen und Gängen und am Rande der Plazas zu beobachten. Salimbene bemerkte sie als erster, und er wußte sofort Bescheid.
„Die anderen sind auch schon unterwegs“, raunte er seinen beiden Kumpanen zu. „Wir müssen uns beeilen.“
„Sonst bleibt für uns nichts übrig“, murmelte El Moreno. „Wir sollten uns als erstes die Münze vornehmen!“
Sie beschleunigten ihre Schritte. Sie dachten nur an das eine: Silber, Reichtum, eine günstige Gelegenheit, sich zu bereichern, eine Chance, die sich in dieser Form nie wieder bieten würde. Potosi gehörte dem lichtscheuen Gesindel, den Dieben, Marodeuren und Galgenstricken.
Die drei Kerle irrten sich nicht: Der Feind hatte Potosi verlassen. Philip Hasard Killigrew, der Seewolf, und sein Trupp hatten der Stadt noch an diesem Abend den Rücken gekehrt und zogen westwärts. Sie befanden sich auf der Route – eine Art Straße, wenn man sie so nennen wollte –, die durch das Gebirge von Potosi nach Arica führte.
Hasard musterte nicht ohne Stolz seine Begleiter. Sie hatten sich großartig geschlagen. Jetzt hatte er die Gewißheit, daß er den kleinen Trupp richtig zusammengestellt hatte. Bei ihm waren Jean Ribault, Karl von Hutten, Pater David, Pater Aloysius – als Bergführer und „Lotse“ –, Dan O’Flynn, Carberry, Matt Davies, Gary Andrews, Stenmark und Mel Ferrow.
Fred Finley hatte den Marsch unterbrechen müssen, weil er sich den Fußknöchel gebrochen hatte. Er befand sich bei einer Indio-Familie, die ihn pflegte. Dort würden sie ihn auch wieder abholen.
Mit von der Partie waren auch drei Indios aus dem Tacna-Tal, die vor Zwei Jahren nach Potosi verschleppt worden waren. Sie hießen Toparca, Chupa und Atitla. Hasard und seine Männer hatten sie wie die anderen Sklaven aus der Gefangenschaft befreit. Endlich konnten sie in ihre Heimat und zu ihren Angehörigen zurückkehren.
Hasard konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen, als er zu dem dicken Don Ramón de Cubillo blickte. Der sehr ehrenwerte und hochwohlgeborene Señor Provinzgouverneur von Potosi schien am Ende seiner Kräfte zu sein. Nur schnaufend bewegte er sich voran. Geschieht dir recht, dachte der Seewolf, und es ist noch die geringste Strafe.
Im übrigen schien der Señor Furcht vor den zwanzig Maultieren zu haben, besonders aber vor Diego, Carberrys besonderem Liebling, der bei den unmöglichsten Anlässen Trompetensignale loszulassen pflegte.
Die Animosität war aber nicht einseitig. Diego beäugte den Dicken hin und wieder, als verspüre er Lust, ihm mit seinen Hinterhufen kräftig gegen den Bauch zu trampeln.
Zehn von den Maultieren waren mit Silberbarrenkisten beladen. Auf die zehn anderen Maultiere – darunter auch Diego – hatten die Männer ihr Gepäck verladen. Zum Beispiel die Waffen: In Potosi hatten sie sich endlich auch wieder Musketen und Blunderbusses besorgt, auf die sie während des langen Marsches zu ihrem Ziel aus praktischen Gründen verzichtet hatten. Sie hatten sie sich aus dem Zeughaus von Potosi geholt. Ebenso hatten sie sich reichlich Pulver in handlichen kleinen Fässern beschafft, die sie aus dem danach gesprengten Pulverturm hatten „mitgehen“ lassen.
Auch ihren Proviant hatten sie in Potosi entsprechend ergänzt, damit kein Mangel an Nahrung bestand. Trinkwasser und Wein waren auch ausreichend vorhanden – und Kleidung. Zelte und Decken gehörten mit zu der Ausrüstung. Pater Aloysius hatte sie nicht oft genug darauf hingewiesen, wie wichtig gerade sie für die Expedition waren.
Bewußt hatte der Seewolf die Aricaroute gewählt.
„Wir bleiben zunächst auf dieser Strecke“, sagte er zu Ribault und den anderen, als sie eine erste kurze Rast einlegten.
„Du bist dir also nach wie vor sicher, daß man uns folgen wird?“ fragte Karl von Hutten.
„Ganz sicher sogar“, entgegnete Hasard. „Sobald die Leute in Potosi den Schock der plötzlichen Ereignisse überwunden haben, wird sich dort einiges ändern.“
„Früher oder später begreifen sie, daß sie vor ganzen elf Männern kapituliert haben“, sagte Ribault grinsend. „Ich schätze, dann verspüren sie große Lust, sich selbst in den Hintern zu beißen.“
Hasard lachte leise. „Eins steht jedenfalls fest: Die Dons werden Monate brauchen, um wieder Silber abbauen zu können.“
„Ganz abgesehen davon, daß die Silbermühlen und sämtliche Gerätschaften zur Silbergewinnung einschließlich der Vorrichtungen zum Schmelzen, Gießen und Prägen zerstört sind“, sagte Dan. „Das braucht schon seine Zeit. Vielleicht ein ganzes Jahr.“
„Von mir aus auch mehr, verdammt noch mal“, sagte der Profos. „Und wenn sie alles wieder in Ordnung haben, besuchen wir sie noch mal. Was?“
Er blickte drohend zu Don Ramón, und dieser verschluckte sich und begann zu husten. Als er registrierte, daß auch die drei Indios ihn mit unverhohlener Mordlust musterten, brach ihm der Schweiß aus.
„Das nennt man Tabula rasa“, sagte Pater David. „Reiner Tisch ist gemacht worden – was die gesamte Silberausbeute betrifft, vom Abbau bis zur Münze oder zum Barren.“
„Ein feines Stück Arbeit“, sagte Pater Aloysius grimmig. „So ganz nach meinem Geschmack. Freunde, ich werde ewig den Tag loben, an dem ihr nach Tacna gekommen seid. Das allerschönste aber ist, daß sich im Cerro Rico kein einziger Sklave mehr befindet.“
„Gut finde ich auch, daß wir die Silbermünzen, die eigentlich für den König von Spanien bestimmt waren, an die befreiten Indios verteilt haben“, sagte Matt Davies. „Das muß den Dons ganz hübsch in die Knochen gefahren sein.“
„Das denke ich auch“, sagte der Seewolf. „Aber es könnte einige Konsequenzen nach sich ziehen, habt ihr darüber schon nachgedacht?“
„Sie verlassen alle Mann Potosi?“ fragte Carberry. „Meinst du das?“
„Nicht ganz.“
„Laß mich mal raten“, sagte Ribault. Er grinste wieder. „Ich könnte mir ganz gut vorstellen, daß die Señores jetzt keine Rücksicht mehr auf das wertvolle Leben ihres Provinzgouverneurs nehmen, der als Geisel von uns Banditen mitgeschleppt worden ist. Liege ich richtig?“
„Goldrichtig“, erwiderte Hasard. „Was du sagst und was auch ich mir überlegt habe, gilt insbesondere für die Soldaten und Offiziere der Garnison in Potosi, die mit dem Stadtkommandanten auf Befehl des Gouverneurs nach Sucre in Marsch gesetzt worden sind.“
„Das war ein Befehl“, sagte Mel Ferrow. „Ha, so habe ich mich selten amüsiert!“
Don Ramón de Cubillo verstand kein Wort von dem, was sie sprachen, aber natürlich begriff er, daß sie auch über ihn redeten und sogar lachten. Zu der Schmach und Niederlage kam also auch noch diese Schande. Am liebsten wäre er im Erdboden versunken. Er hörte nicht auf zu schwitzen. Es wurde immer schlimmer. Er war klitschnaß, am’ ganzen Leib.
„Also, diese feinen Soldaten mit ihrem Rübenschwein von Kommandanten kriegen allmählich spitz, daß wir sie geleimt haben, meint ihr?“ Carberry grinste noch ein bißchen mehr als Ribault und die anderen.
Don Ramón stöhnte auf, als er diese Fratze im Mondlicht sah. Nie zuvor in seinem durchlauchten Leben war er einem ähnlich gräßlichen Ungeheuer begegnet, dessen war er sicher.
„So ist es“, erwiderte Dan. „Du hast es mal wieder erfaßt, Ed. Denen muß inzwischen aufgegangen sein, daß es keine fremden Truppen gibt, die angeblich Potosi umstellt haben, wie wir es ihnen vorgegaukelt haben.“
„Wir haben sie bald am Hals“, sagte der Seewolf. „Deshalb