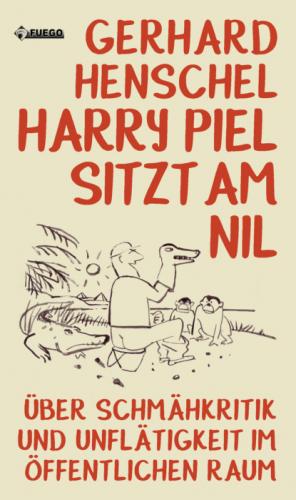Was ich nun nicht all kunnt bemeistern
Das wüßt ich weise zu überkleistern
Hab ihn gelehrt nach Pflichtgrundsätzen
Ein paar Stunden hintereinander schwätzen
Indes er sich am Arsche reibt
Und Wurstel immer Wurstel bleibt.
Zu den Figuren, die er in dem Fragment gebliebenen Stück auftreten lassen wollte, gehören u. a. »Hans Arsch von Rippach«, »Reckärschgen«, »Schnuckfötzgen«,
»Peter Sauschwanz«, »Hosenscheißer«, »Leckarsch«, »Spritzbüchse«, »Fotzenhut«, »Matzpumpes genannt Kuhfladen«, »Heularsch«, »Hans Schiß« und »Nonnenfürzgen«. »Es waren alle erdenklichen Schimpfnamen, mitunter von der derbsten lustigsten Sorte, so daß man nicht aus dem Lachen kam«, notierte Johann Peter Eckermann 1831, nachdem Goethe ihm dieses Jugendwerk vorgelesen hatte. Aber kann es wirklich so lustig gewesen sein, den alten Geheimrat Namen wie »Fotzenhut« und »Heularsch« aussprechen zu hören? Waren die Herren vielleicht etwas angenattert?
Arno Schmidt erkannte in »Hanswursts Hochzeit« nur »säuische Lappalien, nicht wert der Druckerschwärze«, und laut Eckermann hatte Goethe selbst irgendwann das Vergnügen an solchen Lustbarkeiten verloren: »Es war nicht zu denken, daß ich das Stück hätte fertig machen können, sagte Goethe, indem es einen Gipfel von Muthwillen voraussetzte, der mich wohl augenblicklich anwandelte, aber im Grunde nicht in dem Ernst meiner Natur lag, und auf dem ich mich also nicht halten konnte. Und dann sind in Deutschland unsere Kreise zu beschränkt, als daß man mit so etwas hätte hervortreten können.«
Heute kann man’s. Ob man es auch sollte, steht dahin.
*
Füllest wieder Busch und Tal
Still mit Nebelglanz,
Lösest endlich auch einmal
Meine Seele ganz;
Breitest über mein Gefild
Lindernd deinen Blick,
Wie des Freundes Auge, mild
Über mein Geschick.
Diese Eingangsstrophen aus Goethes Gedicht »An den Mond« in der Fassung von 1789 würden uns heute als »Inbegriff eines natürlichen, geruhsamen Sprachblaufes« erscheinen, schrieb der Kunsthistoriker Franz Roh 1948 in seinem Buch »Der verkannte Künstler« und zitierte dann einen Verriß, den der Kritiker Martin Spann 1831 veröffentlicht hatte: »Herr von Goethe apostrophiert allererst den Mond und zwar in der Pöbelsprache, indem er nach Art ungebildeter Menschen in den drei ersten Strophen die Zeitwörter ohne ihre persönlichen Fürwörter,
d. h. ohne ausdrückliche Subjektbesetzung setzet.« Und daß der Mond »seinen Blick lindernd verbreitet, läßt mutmaßen, daß die Gegend an einer schmerzhaften Krankheit leidet«.
Dem Ruhm des Lyrikers Goethe konnten Spanns Einwände nichts anhaben, doch sie zeigen immerhin, welch starken Schwankungen der Eindruck, etwas Ungehöriges zu lesen, zu hören oder zu erblicken, von Mensch zu Mensch, von Land zu Land und von Epoche zu Epoche unterworfen ist und daß selbst den edelsten und sanftmütigsten Kunstgebilden deutscher Sprache Pöbelhaftigkeit nachgesagt werden kann.
*
In seinem Essay »Ein Leben mit Büchern« hat Julian Barnes, Jahrgang 1946, auf die ferne Zeit zurückgeblickt, in der es Heranwachsenden noch schwergefallen war, an unzüchtige Werke zu gelangen: »In Großvaters Bibliothek gab es kaum Schlüpfrigkeiten, außer ein, zwei Szenen in John Masters Roman über den Rückzug der Briten aus Indien, Bhowani Junction; meine Eltern hatten den Kunstband von William Orpen The Outline of Art mit einigen wichtigen Schwarz-Weiß-Abbildungen; doch mein Bruder besaß das Satyricon von Petronius, was das mit Abstand heißeste Buch in den Regalen der Familie war. Die alten Römer führten ein entschieden wilderes Leben als das, was ich in Northwood, Middlesex, mitbekam: Bankette, Sklavinnen, Orgien – lauter solche Sachen. Ich weiß nicht, ob meinem Bruder mit der Zeit auffiel, daß manche Seiten des Satyricon sich lösten und herauszufallen drohten. Doof, wie ich war, nahm ich an, all seine Klassikerausgaben seien ähnlich erotischen Inhalts. Ich verbrachte deshalb viele öde Tage mit seinem Hesiod, bis ich herausfand, dass dem nicht so war.«
Vielleicht hätten ihn aber auch manche Romane enttäuscht, die zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und mitunter noch viele Jahrzehnte danach als himmelschreiend skandalös aufgefaßt worden waren und dennoch herzlich wenig Anrüchiges hergeben, wenn man sie nicht gerade durch die Brille von Fräulein Prysselius betrachtet. Ein solcher Fall ist Friedrich Schleges Roman »Lucinde«, der 1799 erschien und sich »innerhalb der Geschichte deutsch-moralischer Entrüstung« zu einem »Jahrhundert-Ereignis« entwickelte, wie Ludwig Marcuse 1962 schrieb: »›Lucinde‹ hat nie Chancen gehabt, viel gelesen zu werden – trotz des Prestiges, ein Erotikon zu sein. Was in der Zeit, die vor dem Biedermeier schon biedermeierte, als obszön empfunden wurde, ist hier dicht eingehüllt in lyrisch-philosophische Verstiegenheiten; auch die Lüsternsten verlieren die Lust, wo der beschwerliche Weg so unlustig macht. So geht der fragwürdige Ruhm zurück auf den literarischen Skandal, den Schlegel in seinen Tagen hervorrief – und nicht nur damals; er wurde von den Prominentesten konserviert, bis in unser Jahrhundert. Er gab den erlauchtesten Deutschen (von Schiller bis zu Dilthey) Gelegenheit, sich zu entrüsten.« Doch worüber?
»Lucinde« ist ein Wechselbalg aus unbeholfenen Lyrismen und langatmigen Traktaten, und die Suche nach den »Stellen«, aus denen sich der Grund für all die Aufregung erschließen könnte, ist ein mühsames Geschäft. Man erfährt von einer Dame, die durch eine »seltne Gewandtheit und unerschöpfliche Mannichfaltigkeit in allen verführerischen Künsten der Sinnlichkeit« aufgefallen sei und »im Stande der äußersten Verderbtheit« gelebt habe, aber wer Genaueres darüber wissen möchte, muß sich mit der Information begnügen, daß in ihrem Boudoir »einige gute Kopien von den wollüstigen Gemälden des Corregio und Tizian« gehangen hätten, und es habe auch an Marmorskulpturen nicht gefehlt – »ein gieriger Faun, der eine Nymphe, die im Fliehen schon gefallen ist, eben völlig überwinden wird; eine Venus, die mit aufgehobenem Gewande lächelnd über den wollüstigen Rücken auf die Hüften schaut und andere ähnliche Darstellungen«. Von Lucinde heißt es, daß sie sich mit ihrem Liebhaber Julius in einen »Taumel der Nächte« gestürzt habe: »Die hinreißende Kraft und Wärme ihrer Umschließung war mehr als mädchenhaft; sie hatte einen Anhauch von Begeisterung und Tiefe, den nur eine Mutter haben kann. Wenn er sie im Zauberschein einer milden Dämmerung hingegossen sah, konnte er nicht aufhören, die schwellenden Umrisse schmeichelnd zu berühren, und durch die zarte Hülle der ebnen Haut die warmen Strömen des feinsten Lebens zu fühlen.« Und selbst die Apotheose der körperlichen Liebe findet nur einen verhaltenen Ausdruck: »Alles ist beseelt für mich, spricht zu mir und alles ist heilig. Wenn man sich so liebt wie wir, kehrt auch die Natur im Menschen zu ihrer ursprünglichen Göttlichkeit zurück. Die Wollust wird in der einsamen Umarmung der Liebenden wieder, was sie im großen Ganzen ist – das heiligste Wunder der Natur; und was für andre nur etwas ist, dessen sie sich mit Recht schämen müssen, wird für uns wieder, was es an und für sich ist, das reine Feuer der edelsten Lebenskraft.«
Um die Nerven, die von solchen Erklärungen aufgepeitscht wurden, kann es nicht zum besten gestellt gewesen sein. Der Berliner Theologe Daniel Jenisch sah sich sogar dazu veranlaßt, Schlegels Lebensgefährtin Dorothea Veit, die er als Vorbild der Lucinde ansah, öffentlich zu verspotten: In seinem Buch »Diogenes Laterne« publizierte er ein selbstverfaßtes »Billet=doux der geschiedenen Madame Veit, jüdischer Nazion, nunmehr halbverehelichten Friedrich Schlegel, an Herren Friedrich, Schlegel, über seinen Roman, Lucinde«, und vermerkte in einer Fußnote: »Madame Veit, welche Herr Friedrich Schlegel in Berlin kennen lernte, und die deshalb von ihrem bisherigen Ehemanne, nach einjähriger Ehe, geschieden ward. Das Gelächter über den Roman Lucinde, verbunden mit dieser Geschichte, war in Berlin allgemein.« Bereits in diesen einleitenden Worten wird die Absicht deutlich, schmähend in ein fremdes