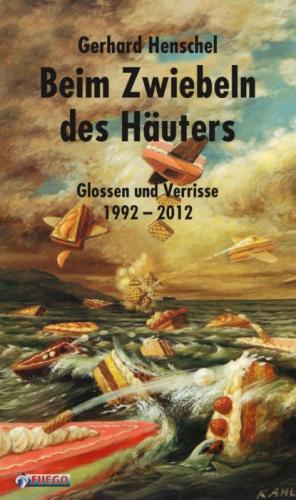Darüber hinaus ist hier zu erfahren, was Volker Braun als erstes einfällt, wenn er an seine Familie denkt (»Geborgenheit, Gefangensein, Zärtlichkeit«), und welche Bitte Hanns Cibulka aus Gotha an »die Spatzen in unserem Leben« richten möchte (»Meine Bitte: Schenkt mir etwas von eurer Zutraulichkeit«).
Beim Ritual der Spatzenhirne scheint es darauf anzukommen, den Schnabel einfach möglichst weit aufzureißen. »Geistig knüpfe ich an die Ideen der Mystik und der Reformation, der Französischen Revolution und der deutschen Aufklärung an«, versichert Uwe Berger, Träger des Heinrich-Heine-Preises und »Abkömmling von Karlshafener Hugenotten«, wie er stolz vermerkt. Der Romancier Reinhard Jirgl wiederum ist der lebende Beweis dafür, dass man den Alfred-Döblin-Preis auch dann nicht zurückgeben muss, wenn man eine »Verbreiterung der Sprachsättigung« in die Literatur einführt. Jirgl schreibt Jirglisch, eine unübersetzbare Fremdsprache (»Die Geschichte eines Landes kontaminiert das Ich mit ihren Komponenten so, wie die Handelnden mit ihrer Sprache den jeweils Anderen okkupieren«). Inwieweit eine solche Verbreiterung der Sprachsättigung zur geistig-kulturellen Einheit beiträgt, sollte recht bald durch eine Kleine Anfrage im Bundestag in Erfahrung gebracht werden.
»Das klingt einleuchtend. Aber ich bin ein Lessing-Typ«, lässt der Hölderlinpreisträger Reiner Kirsch die Menschheit wissen. Der Lyriker Uwe Kolbe ist eher ein Elends-Typ: »Das Land das Nichtland, / das Sein das Nichtsein, / sind sie der Spiegel nicht / und wir die Elenden.« Doch, ganz recht, Uwe Nichtuwe Kolbe Nichtkolbe. Ihr seid die Elenden.
Bernd-Dieter Hüge aus Chemnitz merkt trotzig an, dass er sich »marktgerechter Gefälligkeit« verweigere, doch seine Lyrik spricht nicht dafür, dass er die Wahl hätte: »TEUTSCHLAND MEINE SCHAUER: / du auch mein Glück. Aus vieler Völker Schreie Fluch auf dir / und meiner gallischen Vorväter / Verdammung in mein pruzzisches Blut / geflossen; aber sei dennoch. / Lieben muss ich dich, / will fest sein für dich, / hart«, ja, das ist gut, Bernd-Dieter, steck ihn tiefer rein, den Harten! Bernd-Dieter Hüge reitet auf Deutschland. Gut so. Dann kommt er wenigstens nicht zum Dichten.
An Deutschland leiden die meisten der hier vereinigten Autoren, weil ihnen nicht genug Aufmerksamkeit und Geld geschenkt wird. Der gelernte Rinderzüchter und Lyriker Wilhelm Bartsch aus Eberswalde beklagt »eine spürbare Ausgrenzung achtbarer und gestandener Autorinnen/Autoren aus dem Osten« und tut sich dicke (»Und der Chilene Neruda / legt mir die Hand auf die Schulter«). Für die Dichter aus der Zone sei in Deutschland »nicht einmal Platz am Katzentisch«, schreibt der DDR-Nationalpreisträger Jurij Brezan, ohne daran zu denken, dass der Bundesbildungsminister diesen Katzenjammer finanziert.
Alle fühlen sich ausgegrenzt, missachtet und diskriminiert, belogen und betrogen. »Die Diskriminierung ehemaliger DDR-Autoren müsste aufhören.« Dies wünscht sich Elfriede Brüning. »Wir werden doch abgegrenzt, ›abgewickelt‹. Am liebsten sollten wir gar nicht vorhanden sein.« Der Leipziger Reinhard Bernhof giftet sich darüber, dass die Verlage – er hat keinen – seit neuestem Einnahmen benötigen: »Somit degenerieren sie den Schriftsteller oder töten ihn ab.« Sanitäter! Reinhard Bernhof (»Ja, Poesie ist in uns und das Blut der Freiheit«) schwebt in Lebensgefahr!
Unzufrieden ist auch der Nationalpreisträger Günter Görlich: »Die Suche nach Veröffentlichungsmöglichkeiten ist zeitaufwendig und oft auch ungewohnt deprimierend.« Das Werk der am Katzentisch sitzenden Lessing-Typen »sollte in ganz Deutschland stärker bekannt und beachtet werden«. Volker Ebersbach aus Leipzig behauptet: »In den Mechanismen des freien Marktes überleben Schund und Kitsch besser.« Als die hohe Kunst des Volker Ebersbach. Und er fordert: »Mehr Wettbewerbsvorteile für die Literatur, wenn es sein muss, aus dem Steuersäckel!« Damit Volker Ebersbach sich auf unsere Kosten nach Herzenslust auskäsen kann.
»Ich bin ein Tausendfüßiges geworden / Das durch entstellete Gräser schlappt / Das einen Trippeltrappel hat und / Einen Appel / An der Stirn.« Das hat Kerstin Hensel gedichtet, und sie verlangt dafür eine Extrawurst: »Ich fände es sehr gut, wenn es für freiberufliche Schriftsteller mehr oder überhaupt einen Anspruch auf einen Halbtagsjob gäbe.«
Jeder Müllkutscher leistet bessere und wichtigere Arbeit als diese Tausendfüsigen, aber sie bestehen darauf, ihrer Unverzichtbarkeit wegen unentwegt bezuschusst, bevorzugt, gerühmt und gefüttert zu werden.
Von dem Podium herab, das der Staat ihnen untergeschoben hat, beschweren sie sich darüber, dass sie kein Podium hätten, und sie erheben weitere Forderungen. »Die Verblödung durch das Fernsehen schreitet rasant voran. Man sollte jeden Sender verpflichten, sich zur Literatur zu bekennen und Entsprechendes in sein Programm aufzunehmen«, schreibt der Dichter Günter Kunert. Man sollte doch, man müsste mal – das hätte gerade noch gefehlt, dass Günter Kunert auch noch in der Lindenstraße oder im Aktuellen Sport-Studio eine Kostprobe seiner Dichtkunst zum besten gäbe.
Im Grunde wollen alle nur das eine: Geld. Beate Morgenstern (»Küsse für Butzemännchen«) hat auch schon einen Plan, wie sie an die Otzen kommt: »Beispielsweise könnte man Veröffentlichungen belletristischer Gegenwartsliteratur subventionieren. Mindestens sollte bei einer Erstauflage eine erhebliche Starthilfe gegeben werden, so dass das Verlagsrisiko kleiner wäre.«
Eberhard Panitz (Erich-Weinert-Medaille, Kunstpreis der FDJ, Heinrich-Greif-Filmpreis, Literaturpreis des Demokratischen Frauenbundes, Heinrich-Mann-Preis der Akademie der Künste, Nationalpreis, Goethe-Preis, Kunstpreis des FDGB) hat ebenfalls noch nicht genug in die Scheuer gefahren und weint sich im Auftrag des Bundesbildungsministeriums darüber aus, dass er verteufelt werde: »Solange die Verteufelung der DDR und ihrer vierzigjährigen Geschichte anhält, wird auch die Verteufelung ihrer Literatur und Literaten ziemlich pauschal weitergehen und sich wenig ändern.«
Eine originelle Idee, wie er besser an die Fleischtöpfe kommt, hat der Dichterprediger Walther Petri (»Ich bin klein, aber wichtig«): »Dringend erforderlich erscheint mir, mit angemessenen finanziellen Mitteln nicht nur Kultur generell, sondern in meinem Fall die kleinen aktiven ostdeutschen Verlage zu unterstützen, denn das Wegbrechen von jeglicher Kultur befördert auf eine inkommensurable Weise zerstörerische Tendenzen in der Gesellschaft.« Wenn sie nicht unablässig Stipendien, Preise und Medaillen dafür erhalten, dass sie klein, aber wichtig sind, schwant den Butzemännchen gleich der Untergang des Abendlandes.
Aber ist die geistig-kulturelle Einheit mit Jürgen Fuchs und Bernd-Dieter, mit Lehrerbildnern und Spesenrittern und Freizeitdichtern, die einen Trippeltrappel und einen Appel an der Stirn haben, denn überhaupt erstrebenswert? Was haben die Anthologisten mitzuteilen, das so wichtig ist, dass Theo Waigel Schulden machen muss, um es unter die Leute bringen zu können?
Der zweifache Nationalpreisträger Erik Neutsch zum Beispiel bekämpft den »Alleinvertretungsanspruch der bürgerlichen Ästhetik« mit einem Roman, der davon handelt, dass ein braver Schlossermeister aus dem Osten einen »aus dem Westen stammenden Finanzdezernenten« umbringt, wobei es Neutsch darum geht, »die gesellschaftlichen Hintergründe zu benennen, die im Prozess der Wiedervereinigung auftraten«. Ein pfiffiger Plot: Treten Hintergründe auf, gehen Dezernenten drauf.
Nicht nur der schreibende Bulldozer Neutsch, auch der Dramaturg Bernd Schirmer hat einen großen Wenderoman vorgelegt. Er heißt »Schlehweins Giraffe« und handelt davon, dass ein Zoo im Osten von der Treuhand »abgewickelt« wird. Schlehwein, der Held des Romans, schlurft mit Pinsel und Papier zum Schauplatz des Grauens: »Schlehwein war mit seinem Zeichenblock von Gitter zu Gitter gegangen und hatte die Tiere porträtiert, um sie der Nachwelt zu bewahren. Ich habe nie so traurige Tierbildnisse gesehen.« Das geht ans Herz: Die Wiedervereinigung hatte die Tiere in eine Identitätskrise gestürzt. »Leicht zu verkaufen waren die Rhesus-Äffchen, vor allem an dynamische Jungunternehmer, die sie als besondere Attraktion für ihre neu eröffneten Läden nutzten.«
Kein Klischee wird ausgelassen, jeder noch so spillerige Einfall wird augenblicklich in die Maschine genagelt, und am schönsten ist es, wenn dabei Grammatik und Logik auf der Strecke bleiben. Denn hier kommt Lutz – Lutz Rathenow,